Pavelsbach im Fluss der Zeit
Angabe der [Quellen] am Textende
Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens: [134] (von Wolfgang Fries)
Gemäß den Forschungen der Kommission für bayerische Landesgeschichte (KBLG) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sind als erste historische Schreibformen Pavelsbachs u.a. im Jahre 1249 "Bephensbach", in 1267 "apud Niderenpefenspach" und in 1269 "Paeiffensbach" bekannt.
Nach der von obiger Kommission erarbeiteten Namenserklärung setzt sich der Ortsname aus dem bairisch-mittelhochdeutschen Grundwort "pach" (für kleiner Fluß, Bach oder Rinnsal) und dem oberdeutsch-althochdeutschen Personennamen "Patufrid" bzw. bairisch-althochdeutschen Personennamen "Paldfrid" in der bairisch-mittelhochdeutschen Koseform "Pafi(n)" zusammen.
Hiervon leitet sich die Bedeutung "(Siedlung am) Bach des Pafi(n) oder "(Siedlung an) Pafines Bach" ab. [134]
Bei dem genannten Bach dürfte es sich um den heutigen Loh- bzw. Lachgraben handeln, der bei der Flur "Brollnhof" in den Hengerbach mündet. Zur namensgebenden Person "Patufrid/Paldfrid" sind leider keine Angaben überliefert.
Vorgeschichte und Antike: [1] [2] [3] [33] [60] [61] [67] [77] (von Wolfgang Fries)
Das Gebiet um Pavelsbach war bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Funde des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege weisen mehrere "Mesolithische Freilandstationen" auf dem Gebiet nördlich und westlich des Hoiweihers, im Bereich westlich der Kirche St. Cäcilia sowie in der Flur "Brollnhof" (siehe Flurnamen) nach. [77]
Foto links von David Hawgood, abrufbar über https://commons.wikimedia.org/wiki / Copyright CC BY-SA 2.0 Das Foto zeigt eine einfache Behausung aus leicht zu beschaffenden Materialien. Auch die in Pavelsbach verorteten Freilandstationen befanden sich an einem Wasserlauf, dem heutigen Hengerbach. |
Bei "Mesolithischen Freilandstationen" handelt es sich um regelmäßig genutzte Sommer- bzw. Winterlager nomadisch lebender Jäger und Sammler der Mittelsteinzeit (Zeitraum zwischen 10.000 bis 5.000 vor Chr. --> Mesolithikum).
Das Beutespektrum dieser Menschen bestand aus Waldbewohnern wie Rothirsch, Reh und Wildschwein. Aber auch die Jagd auf Fische, Vögel und Kleintiere wurde nachgewiesen. Das sich erwärmende Klima verbesserte zu jener Zeit auch die Verfügbarkeit von Sammelgut (v.a. Früchte) und begünstigte die Ausbreitung der Haselnuss, die insbesondere im frühen Mesolithikum einen wichtigen Beitrag zur Ernährung leistete. [61]
Aufgrund der Funddichte ist im Gebiet der heutigen Kappl auch eine erste Hirten- und/oder Pflanzerkultur zu vermuten, zumal die neolithische Revolution in den Jahren zwischen 7.000 und 6.000 v. Chr. nachweislich auch in unserer Gegend Einzug hielt. [60] [77]
Bildnachweis neolithische Sichel: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erntemesser.jpg / Copyright: CC BY-SA 3.0
Richtung Seligenporten, in etwa auf Höhe des heutigen Flurkreuzes, sowie im Bereich um die heutige Kappl befanden sich - gemäß den Daten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege - Siedlungsgebiete der Urnenfelderzeit. (1300 - 800 v. Chr.) In dieser Zeit wurde in unserer Gegend vermutlich v. a. Landwirtschaft und Viehzucht betrieben, während andernorts der Bergbau und die Metallverarbeitung (Bronze) im Fokus standen.
Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen sowie Pferde und Hunde dienten den Menschen damals als Haustiere. Neben Weilern - wie bei Pavelsbach - gab es zu dieser Zeit auch Siedlungszentren, die vielfach auf Inselbergen lagen und von einem Wall-Graben-System umgeben waren.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die auf dem Buchberg bei Berngau nachgewiesene urnenfelderzeitliche Höhensiedlung. [76] [77]
Die in der östlich von Pavelsbach in dem Waldgebiet "Stockenau" befindlichen Hügelgräber belegen eine Besiedelung des pavelsbacher Gebiets in der Hallstattzeit (800 - 450 v. Chr. - siehe auch Sehenswürdigkeiten). [77]
Die Hügelgräber in der Pavelsbacher Flur dürften also im selben Zeitraum wie der bekannte „Goldkegel“, der 1953 in der Nähe von Buch (Markt Postbauer-Heng) gefunden wurde, entstanden sein. [1] In der Hallstattzeit wurde auch in Mitteleuropa Eisen verwendet. Zwar brach das alte Fernhandelssystem (Kupfer und Zinn) zusammen, es bildeten sich aber neue Verkehrswege. Durch den Handel mit Eisen entstand auch eine neue Oberschicht. Statt der in der Bronzezeit (bis 800 v. Chr.) üblichen Großsiedlungen (siehe Buchberg) entstanden in unserer Gegend nun Herrenhöfe. [120]
Auch in der Latenezeit (450-15 v. Chr.) war das Gebiet um Pavelsbach besiedelt. Neben den beiden Weilern beim heutigen Flurkreuz Richtung Seligenporten und im Bereich um die heutige Kappl ist vor allem die weit über die Grenzen Pavelsbachs hinaus bekannte Keltenschanze (Viereckschanze) im Waldgebiet "Appel" zu nennen. [1] [76] [77]
Bei der zwischen Pavelsbach und Dippenricht gelegenen, latenezeitlichen Viereckschanze dürfte es sich vermutlich um ein eingefriedetes ländliches Gehöft gehandelt haben.
Bei großflächigen Ausgrabungen verschiedener Viereckschanzen (Ehingen, Bopfingen, Riedlingen, Nordheim) in den Jahren 1984 bis 1997 fanden rennomierte Wissenschaftler wie Rüdiger Krause, Günther Wieland oder Frieder Klein die Grundrisse mehrerer Holzgebäude und Grubenhäuser. Um die Anlagen herum fand man in geringer Entfernung die Grundrisse einer Vielzahl von Häusern aus keltischer Zeit, die zum Teil älter waren als die Schanzen selbst. Einige Viereckschanzen lagen also nicht abgeschieden, sondern waren Bestandteil einer ländlichen Siedlung. [67]
Die ferner gefundenen Schmiedeschlacken, eisernen Tüllenmeißel und Knochengeräte zur Verzierung von Keramik bewiesen handwerkliche Tätigkeit im Innern einer Viereckschanze. [67] Ob diese breite Nutzungsweise auch auf die pavelsbacher Keltenschanze zutrifft, ist bislang nicht geklärt.
Die Keltenschanze ist auch auf den "Urpositionsblättern der Landvermessung Bayern" gut zu erkennen (siehe auch Sehenswürdigkeiten). [2]
Exkurs - Vermessung: Die Vermessung Bayerns erfolgte ab 1808, auf Anordnung von König Maximilian I. Joseph. Hierüber sollte eine gerechte und einheitliche Besteuerung erreicht werden. Ein Link zur betreffenden Website ist der Quellenangabe beigefügt. Die Vermessung des pavelsbacher Gemeindegebiets wurde nach Auskunft des Vermessungsamts Neumarkt in 1830 begonnen und das Urkataster 1839 fertiggestellt. Es trat am 01.01.1840 in Kraft. [3] [33]
Frei zugängliches Online-Kartenmaterial = [77]:
Die Lage der vorgenannten, vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLFD) nachgewiesesenen Siedlungen, kann über den BayernAtlas (Thema Planen und Bauen) abgefragt werden. Nachstehend die Fundbereiche bei der Kappl. Die rot eingefärbten Flächen zeigen das dortige, überraschend große Siedlungsgebiet.
Beschreibung der Fundzonen:
OBEN: Mesolithische Freilandstation, Siedlung der Spätbronze- und Urnenfelderzeit.
LINKS: Siedlungen der Vorgeschichte und der karolingisch-ottonischen Zeit (751 - 1024 n.Chr.)
UNTEN: Hohe Siedlungsdichte von der Mittelsteinzeit, der Urnenfelder- und Spätlatenezeit bis in die frühe Neuzeit (unmittelbar um die Kirche St. Cäcilia).
Das frühe Mittelalter im Gebiet um Pavelsbach: [77]
(von Wolfgang Fries)
In der karolingisch-ottonischen Zeit (751 - 1024 n.Chr.) bestanden Siedlungen westlich der Verbindungsstraße zwischen Pavelsbach und "An der Heide" (direkt nördlich des Hengerbachs) sowie an der Kirche St. Cäcilia. [77] Der Nachweis einer ottonischen Siedlung in unmittelbarer Nähe und direkt am Plateau über dem Hengerbach, bei der es sich um das später als Kyrstetten bekannte Dorf handelte, lässt durchaus den Schluss zu, dass die dortige Kirche St. Cäcilia zu den "frühen Kirchenbauten" der Oberpfalz zählt.
Auch der Name "Kappl" (der in der Oberpfalz nur 5 mal Verwendung findet) und die frühere Wallfahrt (v.a. Augenleiden), die durch die noch vorhandenen Votivtafeln belegt wird, unterstreichen die Bedeutung, die der Kirche St. Cäcilia in früheren Zeiten beigemessen wurde. [121]
Das BLfD hat die beiden Pavelsbacher Kirchen näher untersucht und konnte bei beiden den Nachweis für Vorgängerbauten bzw. ältere Bauphasen erbringen. [77]
Kyrstetten tritt aus dem Dunkel der Zeit [17] [20] [25] [42] [69] [70] [135]
(von Wolfgang Fries)
Die früh- und hochmittelalterliche Geschichtsschreibung erfolgt v.a. über Beurkundungen z.B. im Rahmen von Schenkungen oder im Zuge der Rechtsprechung.
In einer solchen Urkunde des Bischofs Hartwig von Eichstätt (1196-1223) aus dem Frühsommer 1209 wird erstmals das pavelsbacher Ortsgebiet genannt.
In der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem bereits um 800 n. Chr. gegründeten Kloster Solnhofen und dem Adeligen "Ulricus de Hostete" (vermutlich Höchstetten bei Leutershausen) haben hierbei Bischof Hartwig (aus dem Hause derer von Grögling-Dollnstein) sowie die beiden Beisitzer Dompropst Berchtold und Archidiakon Gumbert - im Namen des apostolischen Stuhls - Recht gesprochen.
Als Zeuge oder Bürge dieses Verfahrens wird dort, neben einer ganzen Anzahl von hochgestellten Persönlichkeiten, auch der Landadelige "Ulricus de Chirstet" (Ulrich von Kierstetten) genannt. [17/Seite 162] [20] [42] Landtafel: Rechtehinweis Digitalisat CC BY-NC-SA 4.0 Rechtehinweis Metadaten CCO abgerufen bei bavarikon, dem Onlineportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst, Kultur und Wissensschätzen von der Vor- und Frühgeschichte über Antike und Mittelalter bis hin zur Neuzeit. (Objekt bei der Kultureinrichtung https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00015529?page=,1)
Bezeugt oder verbürgt wurden hier regelmäßig "nur" die Rechstfolgen sowie die Umsetzung des Urteils - oder wie in diesem Falle - die ordnungsgemäße Umsetzung des hier gefundenen Interessensausgleichs. Als Bürgen oder Zeugen eines solchen Verfahrens wurden im aller Regel Verwandte, Lehensherren oder Lehensleute der beteiligten Parteien hinzugezogen.
In welcher Beziehung Ulrich von Kyrstetten zu den Verfahrensparteien steht, ist den Unterlagen leider nicht zu entnehmen. Für eine verwandschaftlichen Beziehung zu dem Beklagten Ulrich von Höchstetten spricht der übereinstimmende Vorname. In den "Sippen" jener Zeit fanden regelmäßig gleichlautende Rufnamen Verwendung. Es ist aber auch eine Lehensabhängigkeit des Ulrich von Kyrstetten vom Kloster Solnhofen denkbar.
Weitere Hinweise auf den "Herrn von Kyrstetten" oder dessen eventuelle Abkömmlinge wurden in den einschlägigen Quellen bislang nicht gefunden. [20] [42]
Leider hat sich die Kommission für bayerische Landesgeschichte (KBLG) noch nicht mit dem Namen des abgegangenen Ortes Kyrstetten beschäftigt. Die Kommision hat aber bereits eine Sichtung (per Mail) angekündigt. Beim Ortsnamen "Kyrstetten" (lateinische Schreibweise "Chirstet") ist augefällig, dass dieser aus einem Bestimmungs- und einem Grundwort zusammensetzt.
Das Bestimmungswort "Kyr-" dürfte vom althochdeutschen Wort "kirihha" [136] für "Kirche" abgeleitet worden sein und deutet somit auf ein Kirchengebäude hin [25] [69].
Das Grundwort "stetten" (vom althochdeutschen Wort „stat“ stammend --> Ort, Stelle, Stätte, Stadt, oder auch „wo Wandernde zum stehen kommen“, also sesshaft werden [69] [135]) lässt den Schluss zu, dass es sich um eine bajuwarische Siedlung gehandelt hat (genauso wie Orte mit den Namensendungen "-ing, -hausen und -hofen"), die im Zeitraum zwischen dem siebten und neunten Jahrhundert auf vorgeschichtlichem Terrain entstand. Einige dieser bajuwarischen Ansiedlungen gab es zunächst in den Gegenden um Cham, Amberg und Schwarzenfeld und wenig später auch um Neumarkt. [70]
Vorstehende Annahmen werden von den Ergebnissen der KBLG zum Namen des von ihr bereits untersuchten, ebenfalls abgegangenen Orts Kirchstetten (im Landkreis Aichach-Friedberg) gestützt. Die dort ermittelte historische Schreibweise des Ortes im Jahre 1453 "zu Kyrchstetten" weist eine frappierende Ähnlichkeit mit der Schreibweise von "Kyrstetten" aus der Stiftungsurkunde des Ulrich Plank aus dem Jahre 1438 auf. Die zu "Kyrchstetten" von der KBLG veröffentlichte Namensbedeutung "Wohnstätte bei/mit einer Kirche" dürfte somit auch für "unser Kyrstetten" zutreffend sein. [135]
Damit kann vom Namen des "Dorfherrn" bzw. des Ortes geschlossen werden, dass sich zum Zeitpunkt der Erstnennung im Jahre 1209 bereits eine (namensgebende) Kirche auf dem Hochplateau über dem Hengerbach befand.
Vermutlich handelte es sich bei diesem Gotteshaus anfangs, wie zur ersten Jahrtausendwende weit verbreitet, nur um ein eher bescheidenes Holzgebäude, dass der hier abgebildeten Holzkirche aus dem Jahre 998 vermutlich ähnelte.
In früheren Zeiten war die hier abgebildete St. Andrew's Church vollständig mit Holzschindeln gedeckt. Die Eindeckung des Langhauses mit roten Dachziegeln erfolgte bei der St. Andrew's Church, der ältesten Holzkirche der Welt, erst um das Jahr 1500. [25] [69] Bildnachweis St. Andrew's Church, älteste Holzkirche der Welt. CC BY-SA 4.0; Werk des Acabashi vom 26.06.2015.
Die Lage der hochmittelalterlichen Siedlung um die ursprünglich gotische Kirche St. Cäcilia wurden durch Lesefunde belegt, die dem Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in Regensburg übergeben wurden. Nachstehende Skizze zeigt den Bereich um die Kappl, in dem diese Funde zu verzeichnen waren.
Kyrstetten zählte somit (zusammen mit Möning) zu den ältesten Orten unserer Gegend.
Die Besiedlung der Oberpfalz scheint zur ersten Jahrtausendwende noch sehr lückenhaft gewesen zu sein. So berichtet Thietmar von Merseburg im Jahr 1003, dass König Heinrich II. nach Speinshart gekommen sei, um Bären und Wisente zu jagen, die andernorts in Folge der regen Siedlungstätigkeit bereits ausgerottet waren. [70 Frühe Besiedlung]
Erste urkundliche Erwähnung Pavelsbachs sowie deren Hintergründe [4] [5] [8] [130] [140] (von Wolfgang Fries)
Erstmals wurde Pavelsbach in einer von Heinrich IV. von Württemberg, Bischof von Eichstätt (1247-1259), am 05. Februar 1249 ausgefertigten Schenkungsurkunde genannt. [4] [8/Seite 24]
[8] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Pyrbaum
Mit freundlicher Genehmigung des Staatsarchivs Amberg nachstehend eine Fotografie oben genannter Urkunde vom 05.02.1249:
(in Zeile 10 ist "bephensbach" gut erkennbar)
Nachstehend eine an den heutigen Sprachgebrauch angepasste Übersetzung vorstehender Urkunde [130]:
Im Namen der hochheiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, Amen. Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden Bischof von Eichstätt, grüße in unseres Erlösers Namen alle Christgläubigen, die dieses Schriftstück lesen werden.
Neben den anderen Zeichen unserer Tugend und Hirtenwürde ist es unsere vornehmlichste Aufgabe, Gutes zu wirken, nicht nur indem wir andere vom Bösen abhalten, sonder auch, indem wir die, die Gutes tun, lieben und ehren und in aller Wachsamkeit beim Guten bewahren; und indem wir dieses tun, dienen wir nicht nur unserem Hirtenamt, sondern auch dem Ruhm unseres Ansehens. Uns so tun wir mit vorliegender Urkunde jedermann für alle Zeit kund, daß Gottfried von Sulbürg und seine Gattin Adelheid, vom Feuer der göttlichen Liebe entzündet, ein Kloster namens Seligenporten auf eigenem Grund und Boden in unserer Diözese gegründet haben. In diesem Kloster haben fromme Dienerinnen Christi, die zusammengekommen sind, um demütig ihrem Herrn nachzufolgen, ihre Profeß nach der Regel des Zisterzienserordens abgelegt. Die vorgenannten Gottfried und seine Frau haben gewisse ihnen eigene Güter dem Kloster und den dort für ihren Herrn Christus kämpfenden Dienerinnen frei zu ewiger Nutzung übertragen und zwar dergestalt, daß weder sie noch ihre Erben unter dem Vorwand von Schirm und Vogtei irgendein Recht fernerhin haben sollen am Kloster oder den obenannten Gütern oder an deren Besitzung, die die genannten Nonnen jetzt besitzen oder in Zukunft noch besitzen werden. (Anmerkung: Das Kloster wurde hierüber von der Gerichtsbarkeit der Sulzbürger freigestellt).
Diese Güter sind: Der Ort selber, wo das Kloster mit seiner Zubehörde steht, ferner drei Höfe in Kittenhausen, drei Höfe in Reuth (Anmerkung: vermutlich bei Heng - dort ist ein entsprechender Flurname bekannt) und zwei in Pavelsbach. Mit diesen Gütern haben die vorgenannten Gottfried und Adelheid die Zehnten abgelöst, die sie seit 1242 von allen ihren Gütern dem genannten Kloster zu geben pflegten. Das Folgende haben sie ebenfalls derselben Kirche übertragen: einige (Zahl nich lesbar) Hufen in Wappersdorf und eine Hufe in Kerkhofen, doch haben später die oftgeannten Nonnen diese Güter im Tausch für zwei kleine Mitgiften in Möning dem Leutepriester von Sulzbürg übertragen.
Zeugen für die Schenkung Gottfrieds und Adelheids sind: Konrad d.J. von Sulzbürg, Ruprecht von Ruprechtstein, Konrad von Hohenfels, Hadamar von Laaber, Konrad von Reckendorf, Rüdiger von Helfenberg, Kuno von Wechthofen, Gottschalk von Schönhofen, Ulrich von Pölling, Gotebold von Ittelhofen, Konrad Löter, Rüdiger von Fürnried und viele andere.
Ferner hat der genannte Konrad d.J von Sulzbürg, der Neffe des Stifters, geleitet von derselben Frömmigkeit, anstelle der Zehnten, die er 1242 ebfalls von allen seinen Gütern an die Kirche Seligenporten zu zahlen beschlossen hatte, ebendieser Kirche folgende Güter zugewiesen: das ganze Dorf Pfaffenhofen und alles, was er in Brunnau besaß, sowie, für das Seelenheil seiner Elteren einen Hof zu Büchenbach (Anmerkung: bei Roth). Zeugen dieser Schenkung sind: Herr Gottfried von Sulzbürg, Onkel des genannten Konrad, Heinrich ...... , Witmann d.J., Hebeno Truchseß (?), Ulrich von Buchfeld, Rudolf von Wappersdorf, Albrecht von Körnersdorf, Konrad von Bürglein, Rüdiger von Fürnried, Heinrich Eibenbrunner(?), Berengar von Pollanten, Heinrich von Rocksdorf.
Da wir nun also aufgrund des uns aufgetragenen bischöflichen Amtes verpflichtet sind, die Kirchen nicht nur im spirituellen, sondern auch im weltlichen Bereich nach Kräften zu fördern, hielten wir es für richtig, den erwähnten Ort samt den dazugehörigen Personen gemäß dem Wunsche des oftgenannten Gottfried und mit Einverständnis unseres Domkapitels gnädig in unseren und des Hl. Willibald Schutz zu nehmen zum Wohle des Zisterzienserordens.
Damit aber diese Anordnungen unumstößlich ihre Gültigkeit bewahren, haben wir das vorliegende Schriftstück, versehen mit unserem und des Domkapitls Siegeln und mit dem Siegel des Abtes von Heilbronn sowie des genannten Gottfried selber, dem obengenannten Kloster an die Hand gegeben. Sollte also irgendeine geistliche oder weltliche Person sich unterstehen, dieses Dekret böswillig zu verdächtigen oder anzufechten, so möge er wissen, deß er damit alle Strafen Gottes, des Apostelfürsten Petrus und des Hl. Willibald auf sich lädt und kraft der uns von Gott gegebenen Autorität verflucht und exkommuniziert sein soll. Wer sich jedoch respektvoll daran hält, möge gnädig in der Schar der Heiligen vor Gottes Thron aufgenommen werden und die ewige Seligkeit genießen.
Gegeben zu Eichstätt im Jahre 1249, im zweiten Jahr unseres Pontifikats in der siebten Indiktion.
Zitat aus: [130/Seiten 86-88]
Wie u.a. auch in der Ortsgeschichte Seligenporten nachzulesen ist, wollte es der Edelfreie Gottfried von Sulzbürg anderen aufsteigenden Reichsministerialen gleichtun und ein Hauskloster auf seinem Besitz errichten. Dafür übergab er als Stifter in 1242 seine Hofmark "zu den Eichen" als Bauplatz. Bis zur Reformation wurden in der Gruft der dort errichteten Klosterkirche nahezu alle verstorbenen Familienmitglieder beigesetzt. [5/Seite 27] [78] [130/Seiten 88 + 89]
[5] Mit freundlicher Genehmigung des "Historischer Verein Neumarkt i.d.Opf. und Umgebung e.V."
Exkurs Adelsgeschlecht der Wolfsteiner/Sulzbürger:
Die Wolfsteiner nannten sich ab 1217 Sulzbürger und ab 1286 dann wieder Wolfsteiner, nach der ihnen gehörenden Burg nahe Neumarkt.
Bei dem letzten Wolfsteiner, der in der Klostergruft in Seligenporten beigesetzt wurde, handelt es sich um den Erbauer des Schlosses Pyrbaum (in 1853 abgebrannt). Dieser Wilhelm II. von Wolfstein verstarb am Palmsonntag 1518.
Noch vor dem Konfessionsübergang der Wolfsteiner wurde die Pyrbaumer Pfarrkirche Sankt Georg, nach deren Fertigstellung um 1519, als neue Grablege der "Wolfsteiner" genutzt.
Wie der einschlägigen Fachliteratur [5] [130] [140] zu entnehmen ist, besaßen die Wolfsteiner - neben ihrem unmittelbaren Herrschaftsgebiet um die Burg Wolfstein, die Gebiete um Sulzbürg (heute noch das "La+ndl" genannt) und Allersberg - vor allem in den Dörfern westlich von Neumarkt (u.a. Pölling, Woffenbach, Möning und Pavelsbach) Höfe, Grundstücks-, Patronats- und Zehntrechte als Lehen. [5/Seite 26] [130]
In den genannnten Dörfern waren meist die Landgrafen zu Leuchtenberg ihre Lehensherren. Insbesondere auf Pavelsbach scheint dies zugetroffen zu haben. Die Leuchtenberger wiederum waren hier in einigen Fällen Lehensleute der Eichstätter Bischöfe. [5/Seite 26]
Erste urkundliche Erwähnung eines Pavelsbachers: [6] [16] [71]
(von Wolfgang Fries)
Johann Nepomuk Reichsfreiherr von Löwenthal schreibt in seinem im August 1805 veröffentlichten Buch "Geschichte des Schultheißenamts und der Stadt Neumarkt" davon, dass der Ministeriale Herrmann von Sulzbürg in 1252 einem "Konrad (genannt Rephan)", für geleistete Dienste, ein Gut in "Babelspach" verliehen hat. [16/Seite 26]
Es steht jedoch nicht fest, dass dieser Konrad das Gut anschließend selbst bewohnt oder aber (wie bis dahin geschehen) verpachtet hat, zumal dieses Gut ja bereits vorher von abgabenpflichtigen, abhängigen Bauersleuten bewirtschaftet wurde. Auch ein Verkauf kann nicht ausgeschlossen werden. Als erster namentlich benannter Pavelsbacher ist dieser Konrad Rephan daher nicht nachweisbar.
Anders verhält es sich - wie bereits der Name anzeigt - mit "Siboto von Pefenspach". Am 11. Oktober 1267 wird dieser "Siboto von Pefenspach" in einer Schenkungsurkunde des Eichstätter Bischofs Hildebrand von Möhren (1261-1279) genannt. [6/Seite 261] Das Kloster Seligenporten erhielt hier den "Zehnt" des Ortes "Niederpefenspach" (heute in Pavelsbach noch Unterdorf genannt).
Bis dahin stand der Zehnt dem Ulrich von Sulzbürg als Lehen der eichstätter Kirche und oben genanntem "Siboto von Pefenspach" als Afterlehen zu.
Über "Siboto von Pefenspach" sind leider keine weiteren Informationen zu finden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei Siboto um einen freien Bauern handelte, der den Zehnt Niederpavelsbachs als Afterlehen, vermutlich für geleistete Dienste, erhalten hatte. Bei dem Namen Siboto (Sigbot) handelt es sich um einen germanischen Personenennamen. [71]
Die Entwicklung Pavelsbach im geschichtlichen Gesamtkontext:
Pavelsbach im Mittelalter:
(von Wolfgang Fries)
Die Gründung des Klosters Seligenporten in 1242 und auch die ersten pavelsbacher Schenkungen in 1249 erfolgten in einer von politischen Rivalitäten und Kämpfen geprägten Zeit. [5/Seite 42]
Der Stauferkaiser Friedrich II. (1194-1250) lebte in erbitterter Feindschaft u.a. mit den Päpsten Gregor IX. (1227-1241) und Innozenz IV. (1243-1254). Der Streit gipfelte in der Exkommunikation des Kaisers am 29. September 1227 und der Wahl von deutschen Gegenkönigen in den Jahren 1245 bzw. 1247 [5/Seiten 42+43] [155] [156] [157]
Um Kaiser und Papst gruppierten sich zwei Parteien, wobei durchaus nicht alle Fürsten auf Seiten des Kaisers und nicht alle Bischöfe auf Seiten des Papstes standen. [5/Seiten 42+43] [155]
Nutznießer dieser Unsicherheiten waren in der Gegend um Pavelsbach das Adelsgeschlecht der Wittelsbacher, der Deutschorden zu Postbauer und in geringerem Maße auch das Kloster Seligenporten, während die Adelsgeschlechter derer von "Leuchtenberg" und "Wolfstein" deutlich an Bedeutung einbüßten. [5/Seite 42 ff.]
Wie die Schenkungen und Verkäufe an das Kloster Seligenporten zeigen, waren im mittelalterlichen Pavelsbach Besitz und Rechte extrem zersplittert. Damit bildet Pavelsbach eine Besonderheit im Raum Neumarkt. [5/Seite 85]
Als Teilherrn finden sich u.a. Gottfried von Sulzbürg (somit ein Wolfsteiner), der Bischof von Eichstätt, Hermann von Stauf (zwischen Eysölden und Thalmässing gelegen), Durenhart von Berbach (südl. v. Eschenau), dessen Neffe Albert von Rückersdorf, die Afterlehensträger Cunrad und Wigelin von Neumarkt zu Nürnberg und die Landgrafen von Leuchtenberg, die dem Kloster Seligenporten am 24. Februar 1269 den Zehnt des Dorfes Oberpavelsbach schenkten. [5/Seite 85] [6] [16] [17/Seite 176] [137/Seite 139]
In 1271 schenken die Neumarkter Bürger Wigelin dem Kloster Seligenporten ein Gut in Pavelsbach. [17/Seite 162] Im gleichen Jahr, am 17. Oktober 1271, verkauft Siegfrid von Kammerstein eine Hube in Paffensbach mit Zustimmung Hermanns von Stauf (RB 3, 376). [140/Seite 82]
Hermann von Stauf übergab in 1277 Güter zu Pavelsbach an das Kloster Seligenporten (Nub. Nr. 570) [137/Seite 40]. Während Oberpavelsbach aufgrund dieser und diverser anderer Schenkungen und Käufe ab 1277 großteils dem Kloster Seligenporten zuzurechnen war, bleibt die grundherrschaftliche Zugehörigkeit des Unterdorfs bis 1317 unklar. [5/Seite 85] [6]
Engelhard von Stein schenkte im Jahre 1310 seinen Teil des Gutes zu Pavelsbach, den er von seinem Vetter Hilpolt II. von Stein zu Lehen trug, dem Kloster Seligenporten. (RB 5, 170) Beurkundet wurde diese Schenkung von Konrad von Strahlenfels (RB 5, 21; Strahelfels ö. Grafenberg/Ofr.) [140/Seite 67]
Am 08. April 1317 schenkte dann der Deutsche König Ludwig der Bayer aus dem Hause Wittelsbach dem Deutschen Orden zu Postbauer die Grundherrschaft u.a. des Dorfes "Nydern Beuenspach" mit allen Rechten.
(Anmerkung: Hiervon nicht betroffen waren die Zehntrechte der Geistlichkeit, also des Klosters Seligenporten und/oder des Pfarrers von Möning)
Nach der betreffenden Urkunde (HStM Ritterorden Lit. Nr. 3556) erhielt der Komtur des Deutschordens zu Franken, Konrad von Gundelfingen, als Vorsteher des "Teutschen Hauses zu Nürenberch die zwey dörfer Schwarzach und Nydern Beuenspach mit gericht und vogtey....mit all den Rechten tas es unser voderen haben an uns bracht unt wie es habent gehabt untz und an den hitigen tach, davon wollen unt haizzen unt gepieten allen unseren ambtleuten....daz weder landvogt noch vogt noch schultheiß zu dem Newenmarch noch kein unser ambtmann des reiches noch von dem Herzentum Beyern mit den Gütern dieda ligent noch mit den Leuten di uf denselben sitzent....nich sullen habent zerschaffen...." [137/Seiten 162+163]
König Ludwig untersagte hier somit jegliche Einmischungen oder Eingriffe durch Amtsträger des Reiches oder der pfälzischen Kurfürsten. Diese Schenkungen waren letztlich eine Belohnung für die Unterstützung des Deutschen Ordens in der Auseinandersetzung des Wittelsbachers Ludwig mit dem Habsburger Gegenkönig Friedrich dem Schönen. [5/Seite 70] [9] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Postbauer-Heng
Am 08. April 1319 verlieh König Ludwig der Bayer dem Kloster Seligenporten das Gut zu Pavelsbach, das der "Ritter Berengar von Polant" an das Kloster verkauft hatte. [137/Seiten 141+197]
Im Jahre 1337 brach ein offener Konflikt zwischen der Klosterherrschaft Seligenporten (Grundherr des Oberdorf) und dem "nidern dorf Peffelsbach...um holtz, umb velt, um wazzer, um wisen, um ecker und um weide" aus. Heftig gestritten wurde gegen die Versuche und Ansprüche der klösterlichen Grundherrschaft, die lebensnotwendigen Nutzungsrechte (Weiderechte / Allmende) der Gemeinde von Niederpavelsbach zu beschneiden.
Am 04. September 1337 fand hierzu ein hochrangig besetztes Schiedsgericht statt. Von Seiten des Deutschen Ordens (für Niederpavelsbach) nahm der Landkomtur der Ballei Franken Heinrich von Zipplingen und für die Zisterzienserinnen aus Seligenporten der Urenkel des Klosterstifters - Albrecht der Jüngere von Wolfstein - teil. Bildnachweis: Grabstein des Heinrich v. Zipplingen im Liebfrauenmünster Donauwört / Werk des -wuppertaler- / CC BY 4.0
Rat holten sich die hohen Herren von fünf Bauern aus Möning, Schwarzach und Rengersricht, die über die Flurgrenzen und Nutzungsgewohnheiten besser Bescheid wußten als die beiden hohen Herren selbst. [5/Seite 142] [9/Seite 39]
Wie dem Wortlaut der Schiedsvereinbarung zu entnehmen ist, mussten die Bauern von dem "nidern dorf von Peffelsbach" die Obere Haid an das Kloster Seligenporten abtreten. [124/Seite 64]
".....daß sie dem Kloster das was innerhalb der Marksteine gelegen ist, die zwischen ihnen jetzt gesetzt werden und was jenseits der Straße gelegen ist, die von Neumarkt gen das Kloster geht, auf der Seite gen Regnoldsreut (Rengersricht) dem Gotteshaus als eigen gehöre". [124/Seite 64]
Zwar wurde vom Schiedsgericht festgelegt, dass sich auch die Bauern des Unterdorfs (bei Gefahr) hinter die Mauern des Klosters Seligenporten flüchten dürfen, [5/Seite 142] [9/Seite 39] diesen klösterlichen Schutz musste sich das Pavelsbacher Unterdorf mit dem Verlust ihrer großen Allmende aber sehr teuer erkaufen.
Im Güterverzeichnis d. Deutschordensamts Postbauer aus dem Jahre 1343 wird eine abgabenpflichtige Wiese "gelegen an dem Kezzelbach gen der Capellen" aufgeführt, die von "Alheit die Leiggebinne und ir sun Seitz" bestellt wurde. Hierfür mussten sie "4 haller auf Walpurgis und 3 kes auf pfingsten" an den Deutschorden liefern. [5/Seite 72] [10] [58/Seite 41/Nr. 101] Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist somit ein Gotteshaus auf dem Hochplateau über dem Hengerbach (der früher den Namen Kesselbach trug) nachgewiesen.
Vermutlich handelt es sich bei der Kappl St. Cäcilia um die Kapelle, die der eichstätter Bischof Gundekar II. in Pavelsbach geweiht haben soll. [43 Gemeinde Postbauer-Heng] [116]
(Anmerkung: Eigene Recherchen im hier verlinkten Gundekarianum [Quelle Nr. 116 Seiten 59 v (LIXv) und 60 r (LXr)] belegen die in der Quelle Nr. 43 (Geschichte des Neumarkter Landkreises) genannte Kirchenweihe in Pavelsbach oder Kyrstetten durch Gundekar II leider nicht. Auch das Diözesanarchiv Eichstätt konnte zu den Pavelsbacher Kirchenweihen keine genauen Daten nennen.)
In oben genanntem "Urbar" aus 1343 wird ferner die Abgabenlast Niederpavelsbachs näher beschrieben. Zu jener Zeit wurde in Pavelsbach anscheinend v.a. Hafer angebaut. Die Unterdorfer mussten hiervon jährlich 365 Metzen an den deutschen Orden liefern. Darüber hinaus mussten 39 "Fastnachtshühner" und 38 "Herbsthühner" und an Geldleistung 240 Haller erbracht werden. [9/Seite 45] [58/Seite 32/Nr. 28]
Die Oberpfalz wurde in den Jahren 1348-1358 erstmals flächendeckend vom Schwarzen Tod (der Pest) heimgesucht. [55] Frühere Ausbrüche der Krankheit sind insbesondere für die Stadt Regensburg dokumentiert. [81/Seite 90] Auch heute noch werden in der Oberpfalz bei Bauarbeiten immer wieder Pestgräber gefunden, zumal die Pest die Menschen Europas bis ins 18te Jahrhundert begleitet hat und in mehreren Wellen über den Kontinent fegte. Nachgewiesen ist, dass etwa die Hälfte der mittelalterlichen Dörfer der Oberpfalz noch vor dem sechzehnten Jahrhundert wieder aufgegeben wurden. [55] Wieviele Pavelsbacher dieser ersten Pandemie zum Opfer gefallen sind, ist nicht überliefert.
Der Deutsche König Wenzel bestätigt 1397 dem Deutschen Orden die in 1317 erfolgte Schenkung des Ortes Niederpavelsbach. [9/Seite 49]
In einer Urkunde von 1429 wird von einem Kriminalfall berichtet, in den auch ein Pavelsbacher verwickelt war. Dem Heinrich Eyben aus Pavelsbach wurde zur Last gelegt, "seine Dirn, des Forsters Tochter von Schwarzach, zu todt geschlagen zu haben". Heinrich Eyben leugnete dies. In den Akten ist vermerkt: "Daz het er nit geton vndt wer daran onscholdig, daz wolt er erweisen alz recht ist". [118]
Er konnte nicht überführt werden und wurde daher vom Schultheiß zu Neuenmarkt Caspar Morspeck und dessen Schöffen (aus Mangel an Beweisen) von den Vorwürfen freigesprochen. [118] (Urkunde: StA Amberg / Kloster Seligenporten Fasz. 41)
Bau eines ersten Gotteshauses in Pavelsbach in 1437/1438: [1] [5] [17] [27] [43] [117] [128] [132] [133] (von Wolfgang Fries)
Den Baubeginn einer Kapelle zu Pavelsbach weisen die Inschrift auf der größeren der ursprünglich zwei Pavelsbacher Glocken ("anno domini 1437 frater paulus trost carmelita in honorem s marie me fvdit") [128] sowie die Stiftungsurkunde des Heinrich Plank, Chorherr zu St. Johann in Regensburg und Pfarrer von Essing (bei Riedenburg), datiert auf den 02.02.1438, nach:
"Zu nutz der beiden Dörfer (Ober- und Niederpavelsbach), die sich verpflichtet haben, einem Frühmesser Gemach, Hausung, Herberg, Stadel und Hofreut zu bereiten und mit allen Sachen zu fertigen". Dafür musste der Frühmesser ihm und seiner Familie ein bis zweimal wöchentlich in einer Seelenmesse gedenken. Ferner hatte der Frühmesser einmal wöchentlich in der Kapelle zu Kyrstetten (der Kappl) eine Messe zu lesen. [1] [5/Seite 130] [17] [27] [132] An dieser Formulierung ist zu erkennen, dass die Kappl und der Ort Kyrstetten spätestens seit 1438 der Zwillingsgemeinde Ober- und Niederpavelsbach zuzurechnen war.
Als Entlohnung stiftet Heinrich Plank Grundstücke, die er vom Kloster Waldsassen gekauft hatte und jährlich immerhin 5 1/4 Pfund Regensburger Pfennige (Regionalwährung) ewig Gilt (unbefristet) einbrachten.
Von den Gemeinden Ober- und Niederpavelsbach wurde - neben der oben näher beschriebenen landwirtschaftlichen Hofstelle (später Hs. Nr. 58) - jeweils ein ganzer Anteil an den Gemeinderechten, "besonders am Holz, soviel als ein Bauer hat" beigesteuert. Das Holz wurde ihm von den "Gemeindern" (der Bevölkerung) angeliefert, gespalten und angeschlichtet.
Die Grundherrschaften des Klosters Seligenporten und auch des Deutschordensamts Postbauer befreiten den Geistlichen von "allen Steuern, Boten, Frohnen und Scharwerken".
Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Stiftung gaben Anna (Steinerin [8/Seite35]), Abtissin von Seligenporten, Eberhard von Stetten, Komtur der Deutschorden-Kommende zu Nürnberg und die Pfarrer von Berngau (Hans Ayrer) und Möning (Ulrich Stocker). (Fotonachweis/Copyright: CC BY-SA 4.0 / Werk des "Angeschichteinteressiertermensch" File:EberhardvonStetten1.jpg)
Die Vorgenannten sowie Konrad Amann (Pfleger zu Postbauer) und Niklas Rauscher (Richter zu Seligenporten) haben die Urkunde mit ihren Siegeln versehen. [1] [5/Seite 130] [17] [27] [132]
Am Sonntag den 19. Oktober 1438 fügt Heinrich Plank seiner Stiftung noch die "Gilten und Zinsen", die er von Hans Hembauer (Bürger in Regensburg) gekauft hat, hinzu. [17] [27]
Hanns Eschbein von Tauernfeld ergänzte die "Plank-Stiftung" am Mittwoch den 06. Januar 1439. "Aus seinen 2 Wiesen, eine genannt die Mooswiese, die andere zu Wilboltsbrunnen" flossen der "Capelle zu Päfelzbach" jährlich 1 halbes Pfund Pfennige zu. Dessen Ehefrau Mechthild Eschbein hat "um ihrer und aller gläubigen Seelen willen" 10 Pfund Pfennige hinzugefügt. [133]
Copyright: Münzkabinett - staatliche Museen zu Berlin (CC BY-SA 4.0)
Eine weitere Ergänzung der Stiftung erfolgte durch Ulrich Plank am 13. April 1445. Auf Bitte seines seligen (verstorbenen) Vetters Heinrich Plank wurden Einkünfte über 40 Gulden aus einer Mess-Stiftung hinzugefügt. [17] [27]
Dem Stifter und der Familie seines Vetters Ulrich Plank (eines Patriziers) in Neumarkt oblag das Patronat über die Pavelsbacher Kirche. Somit bestimmte die Familie Plank, wer die Stelle des Frühmessers in Pavelsbach einnehmen durfte. [1] [5] [17] [27]
Den Anstoß für diese Stiftung dürfte der seinerzeitige Pfarrer von Möning, Ulrich Stocker, gegeben haben, bei dem es sich um den "Oheim" des Stifters Heinrich Plank gehandelt hat. [1] [5] [17] [27]
Die Errichtung dieses Gotteshauses sowie des Pfarrhofes ist vor dem Hintergrund der erst in 1434 beendeten Hussitenkriege als Großtat zu werten, zumal die Hussiten auch die westliche Oberpfalz mit Brand- und Raubzügen überzogen haben. [117] Ob der Zwillingsort Pavelsbach hiervon direkt betroffen war, ist nicht überliefert.
Bekannt ist jedoch der Raubzug der Hussiten in Berg im Jahre 1432. Die Burg zu Berg wurde dabei von den Hussiten erobert, der Burgherr Kurt Voit erschlagen und seine beiden Söhne Kunz und Ulrich sowie sein Schwager Ulrich Pöllinger samt 12 Untertanen nach Prag verschleppt. [5/Seite 144] [43 Gemeinde Berg]
Es ist zu vermuten, dass die Einwohner Pavelsbachs - ähnlich den Untertanen des Pfalzgrafen Johann zu Neumarkt - zur Zahlung einer Kriegssteuer verpflichtet wurden. Nachgewiesen ist, dass jeder Bewohner des kurpfälzischen Hoheitsgebiets ab den 15. Lebensjahr zwischen 2 Groschen und 25 Gulden als Kriegssteuer zu zahlen hatte. [43]
Das ursprünglich im Jahre 1438 in der heutigen Leonhardstr. 2 errichtete Frühmesserhaus wurde in der Folgezeit - spätestens ab 1661 - auch als Schulhaus genutzt und 1886 dann an Privat verkauft. Das Gebäude wurde in den 1990ern abgebrochen.
Niederpavelsbach in 1440 [9]
(von Wolfgang Fries)
Ein Güterverzeichnis des Deutsche Ordens zu Postbauer des Jahres 1440 beschreibt Niederpavelsbach mit 42 "Hofreiten" (~Hofstelle mit Bauernhaus, Nebengebäuden, umfriedetem Garten und Misthaufen) sowie 2 "neuen Hofstätten". Danach bestand Niederpavelsbach seinerzeit aus 44 Anwesen, die zusammen über folgende abgabenpflichtigen Flächen verfügten: Rund 152 Tagwerk Ackerland, 77 1/2 Tagwerk Wiesen und 3 1/2 Tagwerk Wald. Auch die Abgabenlast ist dort festgehalten. Da auch um 1440 in Pavelsbach noch immer v.a. Hafer angebaut wurde, mussten die Unterdorfer 365 Metzen hiervon in Postbauer abliefern. Hinzu kamen noch 47 "Fastnachtshühner", 42 "Herbsthühner", 2 "Pfingstkäse" und 319 Haller 8 Pfennige, die an den deutschen Orden in Postbauer zu zahlen waren. [9/Seiten 45+46]
(Anmerkung: Bei vorstehenden Flächenangaben sind die damals noch wesentlich größeren Allmende nicht enthalten. Dies waren für das Unterdorf ein Teil des Espers (zumindest der heutige Schulwald) und vermutlich auch die Auwiesen sowie der Schacha als Unterdorfer Gemeindewald. Die Nutzungsrechte an ursprünglichen Gemeinschaftsflächen sind teilweise bis heute in den Grundbüchern der damaligen Pavelsbacher Anwesen als Gemeinderecht vermerkt. Dies betrifft in Pavelsbach die Unterdorfer Anwesen mit den alten Hausnummern 1 bis 58)
Darüber hinaus musste der Zehnt an die Kirche (die Klosterherrschaft Seligenporten und/oder an den Pfarrer von Möning) geleistet werden.
Ein erster Streit zwischen Pfarrer und Gemeinde [27] [56]
(von Wolfgang Fries)
In 1455 kam es zwischen dem Frühmesser Ulrich Plank jun. (einem Verwandten des ursprünglichen Stifters) und der Kirchengemeinde Pavelsbach zu einem Streit wegen der Stiftungsgelder aus dem Jahre 1438. Der Geistliche bemängelte, dass eine Zahlung von 2 Gulden (nach heutigen Maßstäben rd. € 2.600,00) nicht geleistet wurde.
Ein Schiedsgericht, dem auch der Erbe des Stifters -Ulrich Plank sen.- (Vetter des ursprünglichen Stifters und Vater des Frühmessers) angehörte, verfügte, dass die Gemeinde dem Frühmesser Holz aus dem Gemeindewald im Wert von 2 Gulden zu liefern habe. Ferner wurde geurteilt, dass dem Frühmesser der Graben um die Kirche zur Nutzung überlassen werden soll.
Warum ein Graben um die Kirche ausgehoben wurde und welche Ausmaße dieser Graben hatte, ist nicht geklärt. Auch ist unklar, ob dieser Graben um die erste Kirche Pavelsbachs zeitweise trocken fiel und als Weide genutzt wurde, oder permanent mit Wasser gefüllt war und somit der Fischzucht dienen konnte. Nachdem der Friedhof Pavelsbachs (wie unten näher beschrieben) in 1602 wegen Nässe zur Kappl verlegt wurde, sind beide Nutzungsarten gut vorstellbar. [27] [56]
Mord und Totschlag bei Pavelsbach [8] [118]
(von Wolfgang Fries)
Im Jahre 1472 wurde der aus Seligenporten stammende Wirt und Brauer "Hannsen Wintersteiner" von einem mordlustigen Trio getötet. "Fritzen Eyben zu Peffelsbach" (Pavelsbach), "Steffen Wolff von Reygkerspuhel" (Röckersbühl) und "Hannsen Sneyder von Perngau" (Berngau) wurden vom "Schultheißen Merten Wildenstein zum Neuenmarkt" u.a. dazu verurteilt in der Pavelsbacher Flur ein Steinkreuz zu errichten.
Welches der ursprünglich 4 Pavelsbacher Steinkreuze (näheres siehe auch Rubrik Sehenswürdigkeiten) die drei Mordbuben dann aufgestellt haben, kann heute leider nicht mehr festgestellt werden. [8 Seite 29] [118] (Urkunde: StA Amberg / Kloster Seligenporten Fasz. 43, J. 1450-1479)
Landshuter Erbfolgekrieg und die Pest von 1504/1505 [5] [70] [81]
(von Wolfgang Fries)
Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Wittelsbachern der Linie Baiern-München und der Pfälzer Kurfürsten führte in unserer Gegend u.a. zur Zerstörung der Dörfer Trautmannshofen, Litzlohe, Lauterhofen und Deinschwang durch Nürnberger Truppen. Auch die Stadt Neumarkt wurde von den "Nürnbergern" belagert, konnte den Angreifern - anders als die damals noch Kurpfälzischen Städte Lauf und Altdorf - jedoch standhalten. [5/Seite 195] [70]
Dass der Zwillingsort Pavelsbach von diesen Kämpfen vemutlich nicht direkt betroffen war, ist mit den akribischen Kriegsvorbereitungen der Stadt Nürnberg im Frühjahr 1504 zu erklären. Durch eine Vielzahl von berittenen Spionen wurde v.a. das Kurpfälzische Herrschaftsgebiet näher untersucht, um bei den geplanten Kampfhandlungen keine Kollateralschäden bei unbeteiligten Dritten Parteien zu verursachen. Somit hat Pavelsbach davon profitiert, dass es größtenteil Deutschordisch war oder dem Kloster Seligenporten zugerechnet wurde.
In den Aufzeichnungen der Stadt Nürnberg aus 1504 ist zu lesen: "Beyfelspach, ein dorf, ein kirch ist pfalzgravisch und der abtisin von der Selige porten."
Auch die Kappl ist dort wie folgt beschrieben: "Sannt Cecilien, ein Kirchlein dobey; ein furt dobey auff der stroß gen Nürnberg der Preitfurt genannt." Vom Ort Kyrstetten ist dort nicht die Rede, so dass darauf geschlossen werden kann, dass bereits in 1504 die Siedlung - wenn überhaupt - nur noch wenige Häuser zählte. [160/Seite 44]
Zwar haben sich die Kampfhandlungen vermutlich nicht direkt auf Pavelsbach und Kyrstetten ausgewirtk, die dem Bayerischen Krieg folgende und gut dokumentierte Pestwelle dürfte aber auch Pavelsbach und Kyrstetten erreicht haben.
Für Neumarkt ist eine Pestepedemie - infolge der Belagerung - überliefert. Verstärkt wurde das Leid der Menschen durch den gleichzeitige Ausbruch der Ruhr in Neumarkt und Umgebung. [81/Seite 97]
Pavelsbach und der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526 [5] [7] [9] [72] [73] [74] [75] (von Wolfgang Fries)
Das 16. Jahrhundert wurde von bedeutenden wirtschaftlichen und auch von erheblichen gesellschaftlichen Veränderungen erschüttert. [72]
Die Wirtschaftskraft und damit auch die Bedeutung der Städte nahm in dieser Epoche - insbesondere wegen des einsetzenden Frühkapitalismus - in erheblichem Maße zu (siehe Fugger in Augsburg), während die Landbevölkerung, wegen der zu leistenden Steuern, Abgaben, Frondienste und Leibeigenschaft, meist am Rande des Existenzminimums lebte. [72]
Hinzu kamen religiöse Verwerfungen wegen der beginnenden Reformation (Martin Lutter / Jan Hus / John Wyclif) [73], der einsetzende Zustrom größerer Mengen an Edelmetallen aus den spanischen Kolonien [74] und ein starkes Bevölkerungswachstum [75].
Als Folge hiervon wurde die menschliche Arbeitskraft immer billiger, während sich Nahrungsmittel - bei gleichzeitiger Geldentwertung - deutlich verteuerten.
Zu dieser, vor allem für die einfache Landbevölkerung schwierigen Lage, gesellten sich dann noch Begehrlichkeiten der örtlichen Grundherren sowie Einschränkungen der Gemeindeautonomie. Insbesondere der vermehrte Zugriff von Grundherren auf Allmende, aber auch die hohe Wilddichte (Verbissschäden) sowie die Belastungen durch die Jagd selbst (tlw. über bestellte Felder sowie Jagdfron) belasteten die ländliche Bevölkerung stark. [72]
Dies dürfte besonders auch auf Pavelsbach zugetroffen haben, zumal sich die Grundherrschaft der damaligen Orte Ober- und Niederpavelsbach größtenteils auf zwei konkurrierende Grundherren verteilte und jede der beiden Parteien ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht war. [5/Seite 142]
Ein Blick auf das Urpositonsblatt (der Landvermessung) Pavelsbachs lässt den Schluß zu, dass sich -im Falle von Pavelsbach- der Deutsche Orden das Flurstück "Auf der untern Haid" aneignete, nachdem sich das Kloster Seligenporten bereits mit Schiedsspruch des Jahres 1337 die Allmende "Auf der obern Haid" als Gegenleistung für ein Schutzversprechen von den Niederpavelsbachern abtreten ließ.
Während die Lage der beiden vergleichsweise großen Flurstücke am Rande des Pavelsbacher Gemeindegebiets diese als Pavelsbacher Allmende ausweist, ist die Tatsache, dass sich beide Flurstücke im heutigen Staatswald *) befinden, als Nachweis für oben näher beschriebene Übereignung zu sehen. Letztlich haben beide Grundherrschaften ihre deutlich stärkere Rechtsposition zu Lasten der Pavelsbacher Dorfbewohner ausgenutzt. *) wegen der Säkularisation in 1804 der Klosterherrschaft Seligenporten bzw. in 1806 des Deutschordenamts Postbauer
Aber auch die in dieser Zeit nachweisbaren Bestrebungen des Pfalzgrafen (als Lehensherrn des Klosters Seligenporten), mittels Repressionen seinen Einfluss auf Niederpavelsbach (dem Deutschen Orden zugehörig) auszudehnen, hat die Lebenssituation der (Nieder)Pavelsbacher stark beeinträchtigt. [5/Seite 206] [9/Seiten 62-64]
Es wundert daher nicht, dass sich mehrere Bauern aus Pavelsbach "empörten" und sich dem "Mässinger Haufe" angeschlossen haben. Namentlich bekannt sind Max Schmidt und Ulrich Schuster. Wobei es sich bei Letztgenanntem sogar um einen Hauptmann des Mässinger Haufens gehandelt haben soll. (siehe auch BayHStAM Kurbayern Äußeres Archiv 2137 f 147)
Diese anfangs nur wenige Bauern zählende Truppe hatte sich zunächst in Thalmässing formiert und setzte sich aus Männern der gesamten Region zusammen. Am 21. April 1525 zog diese "Truppe" auf den Hofberg bei Obermässing und nahmen die dortige bischöfliche Burg mittels einer List ein. Ebenfalls bereits am 21. April 1525 konnte der "Mässinger Haufe" die von einer Mauer umgebene Stadt Greding kampflos einnehmen. [7]
Im Laufe des 22. April wuchs der Haufe dann auf ca. 800 Mann an, während immer noch weitere Bauern aus allen Richtungen zum Mässinger Hofberg strömten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht erreichte der "Mässinger Haufe" eine Stärke von 8.000 Mann. [7]
Aufgrund mangelnder Bewaffnung gelang es am 23. April 1525 der "Mässinger Haufe" nicht, die befestigte Stadt Beilngries einzunehmen. Die Truppe zog sich Richtung Plankstetten zurück. Das unbefestigte Kloster Plankstetten musste für das Scheitern vor Beilngries büßen, wurde vollständig ausgeplündert und ging anschließend in Flammen auf. [5/Seite 217] [7]
Auch die Burgen Brunneck (bei Altdorf im Anlautertal, Lkr. Eichstätt) und Liebeneck (bei Mettendorf Lkr. Roth) sowie das Schloss Thannhausen wurden in den folgenden Tagen von den "Mässingern" eingenommen und geplündert. [7]
Zu weiteren militärischen Aktionen des Mässinger Haufens kam es nicht mehr. Die Aufständischen nahmen vielmehr - unter Vermittlung der Reichsstadt Nürnberg - Verhandlungen mit der Fürstenseite auf. [7]
Auf Herrschaftlicher Seite griff u.a. Markgraf Casimir von Brandenburg-Kulmbach ein, der - unter dem Befehl des Kaspar von Seckendorf - eine Abteilung ansbachischer Reiter gegen den Mässinger Hofberg entsandte. [130/Seite 23]
Das Kommando über die Bewaffneten der Grundherrschaften übernahm jedoch der neumarkter Pfalzgraf Friedrich II., der die Truppen am 01. Mai 1525 in der Nähe von Freystadt, am Kauerlacher Weiher, zusammenzog. Insgesamt verfügte er zwar nur über 500 Mann (teils Fußknechte, teils Reiterei), von großer Bedeutung aber waren seine Feldgeschütze. [7]
Als erfahrener Feldherr griff er zu einer Kriegslist. Um die Aufständischen über die tatsächliche Truppenstärke zu täuschen, ließ er am Kauerlacher Weiher absichtlich ein größeres Lager mit einer Vielzahl von Lagerfeuern anlegen (die vom Hofberg aus gut zu erkennen waren). Gleichzeitig schickte er einen Emissär mit einem Ultimatum ins Lager der Bauern. Er forderte von Ihnen die Waffen niederzulegen und sofort heimzuziehen. [7]
Obwohl Pfalzgraf Friedrich von Neumarkt keine allgemeine Straffreiheit zusichern wollte, kam es im Lager der Bauern dennoch zu einer Spaltung. Ein Teil war bereit das Angebot anzunehmen und zog ab. Ein radikalerer Teil (darunter die oben genannten beiden Pavelsbacher) lehnte ab und suchte den Kampf. [7]
Da die ihm zur Verfügung stehenden "Landsknechte" zahlenmäßig immer noch weit unterlegen waren, konnte Pfalzgraf Friedrich keinen Frontalangriff wagen und schickte daher - in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1525 - eine kleine Truppe mit dem Befehl aus, die in unmittelbarer Nähe zum Mässinger Hofberg gelegenen Mühlen in Brand zu setzen und das dort grasende Schlachtvieh (die Verpflegung der Bauerntruppe) wegzutreiben. [7]
Gleichzeitig ließ Pfalzgraf Friedrich das Lager der Bauern durch Kundschafter ausspähen. Diese meldeten dem überraschten Pfalzgrafen, dass "die Bauern seien alle in der nacht gewichen". [7]
Unmittelbar danach begannen Strafaktionen, bei denen Pfalzgraf Friedrich seine aufrührerischen Untertanen (zum Teil also auch Pavelsbacher) mit hohen Strafzahlungen überzog. Gleichzeitig zeigte er aber auch bei Bauern Milde, die von den Aufständischen zur Mässinger Haufe gezwungen wurden. Keine Gnade gab es für die Hauptleute und Anführer der Bauern, derer man habhaft wurde. Fünfzehn von Ihnen wurden ohne Gerichtsurteil hingerichtet. [5/Seiten 216 + 217] [7]
Dass dies nicht mehr waren lag daran, dass eine größere Anzahl von Bauern-Hauptleuten in die Reichsstadt Nürnberg flüchete. Von den 35 Bauern, die gemäß Pfalzgraf Friedrich nach Nürnberg entkamen, sind 5 namentlich bekannt. Dazu zählen auch die beiden oben bereits genannten Pavelsbacher Max Schmidt und Ulrich Schuster. [5/Seiten 216 + 217] [7]
[7 Gesamtwerk] Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Dr. Josef Seger, Autor des Buches "Der Bauernkrieg im Hochstift Eichstätt".
Regelung der Gerichtsbarkeit [5] [9] [137]
(von Wolfgang Fries)
Über Jahrzehnte hinweg versuchten die neumarkter Pfalzgrafen ihre Hoheitsrechte auf die Orte westlich von Neumarkt auszudehnen, obwohl diese Gegend zum Teil auch dem deutschen Orden oder dem Hochstift Eichstätt zuzurechnen waren. Am 15. August 1535 schlossen Friedrich der II. von der Pfalz mit dem Deutschen Orden einen Vertrag, der die Gerichtsbarkeit (auch) im pavelsbacher Unterdorf regelte. Demnach lag die hohe Gerichtsbarkeit in pfalzgräflicher Hand, während die Niedergerichtsbarkeit (alles was mit "Raufen, Ehebruch, Übermähen, Überackern, mit Schulden, Zins und Gült" zusammenhängt) beim Pflegamt Postbauer verblieb. [5/Seite 213] [9/Seiten 64-66] [137/Seite 165]
Von der Kappl, dem Fürstenaufstand und dem Zweiten Markgrafenkrieg: [5] [10] [17] [68] [94] [95]
(von Wolfgang Fries)
Der Aufstand protestantischer Fürsten, unter der Führung des Moritz von Sachsen, gegen Kaiser Karl V. im Jahre 1552, markierte eine Phase der politischen Wirren sowie der Gesetzlosigkeit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und mündete u.a. auch im Zweiten Markgrafenkrieg (1552-1554). [68]
In Folge dieser Wirren wurde 1552 "die Cäciliakirche von Kriegsvölkern weggebrannt". Die dortige Siedlung namens Kyrstetten hat vermutlich dasselbe Schicksal getroffen. Dies dürfte das Ende dieses mysteriösen Ortes eingeläutet haben, auch wenn auf einer Karte von 1748 noch einige Häuser um die Kappl herum eingezeichnet sind. [10] (17]
Wer diese brennenden Kriegsvölker von 1552 waren, lässt sich heute nicht mehr mit letzter Sicherheit feststellen. Es könnte sich dabei um Bewaffnete von norddeutschen protestantischen Fürsten auf ihrem Kriegszug über Süddeutschland bis nach Tirol gehandelt haben. Auch die Truppen des Markgrafen Albercht II. Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, der bei seiner kriegerischen Auseinandersetzung mit der Freien Reichsstadt Nürnberg deren Umland plünderte, kommen hierfür in Betracht. [68] [94] [95]
Kyrstetten könnte aber auch ein Kollateralschaden der sich im Jahre 1552 in und um Nürnberg herum bewegenden Landsknechte Kaiser Karls des V. oder des Herzogs von Alba mit seinen italienischen und spanischen Truppen oder gar von Bewaffneten aus Nürnberg geworden sein. [94/Seite 123] [95/Seite 298 ff.]
Kyrstetten teilt damit das Schicksal der beiden Städte Altdorf und Lauf, von 3 Klöstern (Engelthal, Pillenreuth, Gründlach), 19 Schlössern, 75 Herrensitzen, 16 (weiteren) Kirchen, 28 Mühlen und rd. 170 Dörfern und Ortschaften in unserer Gegend, die in den Jahren 1552 und 1553 von den diversen Kriegsparteien zerstört wurden. [94/Seite 123] [95/Seite 298 ff.]
In den Folgejahren wurde die Kirche St. Cäcilia zumindest notdürftig repariert und tlw. als Wohnraum genutzt (aus der Not heraus, da ja der Ort Kyrstetten vermutlich großteils abgebrannt ist). Belegt wird dies durch das Möninger Taufregister von 1559, wo vermerkt ist, dass "dem Ulrich Rieß derzeit in der Kapellen St. Cäcilia wonendt ist den 4. Juni ein ehelich Kind getauft worden mit Namen Catharina". [10] [17]
Pavelsbach und die Reformation: [1] [8] [9] [10] [73]
(von Wolfgang Fries)
Die Reformationszeit und vor allem der Augsburger Religionsfriede von 1555 mit dem Grundsatz, dass der Landesherr über die Konfession in seinem Territorium entscheidet, hatte erhebliche Auswirkung auf Pavelsbach.
Obwohl der Kurfürst Ottheinich von der Pfalz (aus der Familie der Wittelsbacher) bereits 1556 zum Protestantismus wechselte, konnte die letzte Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Seligenporten, Anna von Kuedorf, in ihrem Bereich den Glaubenswechsel *) - und damit die Auflösung des Klosters - noch längere Zeit verhindern. Mit ihrem Tode 1576 wurde dann (im Zuge einer ersten Säkularisation) das Kloster endgültig aufgelöst. Die pavelsbacher Besitzungen des Klosters (=große Teile des Oberdorfs) gingen damit an den Pfalzgrafen Friedrich III. [8/Seite 7]
[8] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Pyrbaum
*) Dies galt nachweislich nicht für Pavelsbach, da der damalige "Zwillingsort" Ober- und Niederpavelsbach verschiedenen "Grundherrn" zuzurechnen war.
Auch das Pflegamt Postbauer des Deutschen Ordens, als Grundherr von Niederpavelsbach, geriet während der Reformation von Seiten der Pfalzgrafen unter Druck. Insbesondere nachdem die Kurfürstenwitwe Dorothea (Prinzession von Dänemark und Norwegen) 1580 und der Pfalzgraf Ludwig VI 1583 verstorben waren und Johann Kasimir von Pfalz-Simmern bis 1592 die Regentschaft in der "Oberpfalz" übernahm. Der bekennende Calvinist wurde als Regent eingesetzt, da der eigentliche Landesherr Friedrich IV. von der Pfalz, bei seiner Thronbesteigung erst 9 Jahre alt war. [9/Seite 67 ff.]
Die Pfarrei Pavelsbach [1] [10]
(von Wolfgang Fries)
Für Pavelsbach bedeuteten die vorstehenden Konfessionswirren im Zeitraum von 1556 bis 1626 die kirchliche Eigenständigkeit als teils lutherische und teils calvinistische Kirchengemeinde. Die im vorgenannten Zeitraum in Pavelsbach bestellten Geistlichen sind unter der Rubrik "Pfarrgemeinde" nachzulesen. [1]
Dies galt aber anscheinend für die notdürftig reparierte Kappl zunächst nicht, da in der Pfarrfassion (Steuerkataster) der Pfarrei Möning von 1563 folgendes vermerkt ist: "Die Kapellen Kyrstetten gehören mit allen Intraden (Einkünften) in die Pfarrei Möning". Ein weiteres Indiz hierfür liefert der Eintrag im Kirchenbuch zu Möning von 1561: "Den 13. Oktober ist Lönhart Frank derzeit Capelbruder bei St. Cäcilien ein ehelich Kind Elisabeth getauft worden". [10]
Pest- und Seuchenwellen von 1582-1599 [81]
(von Wolfgang Fries)
Bereits für das erste Seuchenjahr berichten Chronisten von 40 Toten in Neumarkt. [81/Seite 101] In 1599 kamen dann auch noch eine Pockenepedemie (Blattern) hinzu. Für Neumarkt und Pölling sind zahlreiche Tote dokumentiert. Da die gesamte Oberpfalz und auch das benachbarte Franken von der Epedemie betroffen waren, [81/Seite 102] kann getrost davon ausgegangen werden, dass auch Pavelsbach und Kyrstetten von diesen schweren Krankheitswellen erfasst wurden.
Nachgewiesen ist ferner, dass es in Neumarkt und auch im nahen fränkischen Raum in den Folgejahren (von 1602 bis 1613) noch zu vereinzelten Pestfällen kam. [81/Seite 104]
St. Christophorus blieb in Pavelsbach bis 1598 [5] [27] [81]
(von Wolfgang Fries)
Ab 1593 (bis 1600) predigte Pfarrer Leonhard Berkringer den Calvinismus in Pavelsbach. Diese neue Glaubensrichtung wurde ab 1592 in der Oberpfalz zwangsweise eingeführt. Mit den Neuerungen taten sich nachweislich aber nicht nur die Pavelsbacher schwer. [5/Seite 238 ff.] [27]
Anscheinend gelang es Pfarrer Berkringer nicht, die neue Glaubensrichtung vollumfänglich in der Pavelsbacher Bevölkerung zu verankern. Denn obwohl bildliche Heiligendarstellungen im Calvinismus als "papistische, abgöttische Bildnisse" streng verboten waren, musste in 1598 ein Visitator des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz feststellen, dass in der Kirche zu Pavelsbach ein Christophorusbild nicht übertüncht war. [81/Seite 44]
Verlegung des Friedhofs und Neubau der Kirche St. Cäcilia: [10]
(von Wolfgang Fries)
Da der Gottesacker um die Kirche in Pavelsbach herum zu feucht war, ließ der seinerzeitige, calvinistische Ortsgeistliche Theodor Ziegelmair im Jahre 1602 den Friedhof zur Kappl verlegen (siehe auch Rubrik "Pfarrgemeinde). Im gleichen Jahr wurde auch mit dem Neubau der Cäciliakirche begonnen. Die Bauarbeiten haben sich dann bis 1608 hingezogen.
Als Organisator und Finanzier dieses Kraftakts kommt in erster Linie wohl das Deutschordensamt Postbauer in Frage, zumal sich die Kappl auf einem Grundstück des Deutschen Ordens befand.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht nur die Untertanen des Deutschen Ordens, die Bewohner von Niederpavelsbach, für diesen Kirchenneubau zu Hand- und Spanndiensten herangezogen wurden.
Vielmehr dürften sich auch die (nach der Brandschatzung von 1552) verbliebenen, wenigen Einwohner Kyrstettens und auch die Bewohner von Oberpavelsbach (zu jener Zeit Untertanen des Friedrich IV. von der Pfalz) an dem Neubau beteiligt haben. Belegt ist die Fertigstellung der Kirche St. Cäcilia im Jahre 1608. Damit handelt es sich bei der Kappl um das älteste Gebäude Pavelsbachs. [10]
Eine dritte Glocke für Pavelsbach [17] [27] [126] [128]
(von Wolfgang Fries)
Im Jahre 1611 wurde von den Pavelsbachern eine "große Glocke" für ihre Kirche angschafft. Gegossen wurde sie von Johann Pfeffer in Nürnberg.[27 Seite 55] Die Glocke ziert folgende umlaufende Inschrift: "zu gottes wort vnd dinst gehor ich" Und weiter: "iohannes pfeffer in nvrnmberg gos mich anno : 16 11".
Die neue Glocke vervollständigte das dreistimmige Geläut, das bis in die 1950er Jahre in Pavelsbach erklang. Die beiden damals bereits vorhandenen Glocken sind auch heute noch im Einsatz. Die kleine Glocke aus dem 15. Jahrhundert [17/Seite 175] befindet sich auf dem Turm der Kappl, die mittlere Glocke aus dem Jahre 1437 verrichtet ihren Dienst in Michelbach in der Ortskapelle St. Maria. [126/Seite 9] [128]
Mit einem Gewicht von 400 kg und einem Durchmesser von 883 mm ist die damalige "Große Glocke" heute nur noch die zweitgrößte der vier Glocken im Turm der Dorfkirche. Näheres zum Pavelsbacher Geläut auch unter der Rubrik "Sehenswürdigkeiten / Kirche St. Leonhard". [126/Seite 9]
Pavelsbach und der Dreißigjährige Krieg: [11] [12] [13]
(von Wolfgang Fries)
Für Pavelsbach und Kyrstetten bedeutete der Dreißigjährige Krieg eine tiefe Zäsur, zumal die Oberpfalz in besonderer Härte von den Kriegswirren betroffen war.
Einer der "Mitauslöser" dieses Konfessionskriegs war Kurfürst von der Pfalz Friedrich V., dem - als Protestanten - in 1619 die Königswürde Böhmens angetragen wurde. Auch auf Betreiben seiner Gemahlin Elisabeth (Tochter König Jakobs I. von England) ließ er sich 1619 zum König von Böhmen krönen und stellte sich damit gegen Kaiser Ferdinand II.
Bereits nach der ersten großen militärischen Auseinandersetzung des Dreißigjährigen Kriegs, der Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 08. November 1620, verlor Pfalzgraf Friedrich V. nicht nur die Königswürde, sondern, durch Verhängung der Reichsacht, auch seine Kurwürde und sein Herrschaftsgebiet - die Pfalz - an Herzog Maximilian I. von Bayern.
Ab 1620 setzten in der Umgebung von Pavelsbach Truppendurchzüge ein. Das Verhalten der Soldaten war geprägt von Plünderung und Gewalt.
Im Juli 1632 marschierte die gesamte kaiserliche und bayerische Armee mit rd. 70.000 Mann durch das Pavelsbacher Gebiet. Gleichzeitig unternahmen die Schweden von Nürnberg aus Streifzüge auch in unsere Gegend.
Mit Eroberung Regensburgs durch die Schweden 1633 wurden diese Truppendurchzüge immer häufiger. Im November 1633 berichtet Fabian Adelmann, Pfleger des Deutschordenamtes Postbauer über die Situation in den deutschordischen Dörfern - dies betraf somit auch Pavelsbach. Er schrieb, dass "seine Untertanen in alle Winde zerstreut seien und er nicht einmal mehr zehn finden könne. Die schwedischen Reiter hätten die Leute dermaßen mit Raub, Mord und Brand heimgesucht, dass sich ein Stein hätte erbarmen können. Weil viele keinen Bissen Brot mehr und kein Sommerkorn hätten, wären viele gestorben. Die Felder lägen unbesät, weil den Leuten Samen und Pferde fehlten. Viele Güter wären verbrannt."
Aufgrund der katastrophalen hygienischen Verhältnisse - hunderte von nicht bestatteten Leichen verpesteten die Luft in den Häusern und Gassen, verendetes Vieh warfen die Landskrencht tlw. in die Brunnen - brach dann in 1634 auch noch die Pest erneut aus.
In 1635 räumten dann die Schweden Neumarkt und bayerische Truppen rückten ein. Für die Bewohner der umliegenden Dörfer bestand aber weiterhin die Gefahr von Raubzügen entlassener Soldaten.
Da in dieser Zeit in der Oberpfalz Gewaltexzesse an der Tagesordnung waren, griff in 1636 auch Kurfürst Maximilian I. von Bayern ein und befahl die Bewaffnung von "Landfähnlein" aus Beständen des Amberger Zeughauses, um ein wirksames Vorgehen gegen diese Plünderer zu ermöglichen.
Der Kaiser ordnete - ebenfalls in 1636 - an, die Oberpfalz von Truppendurchzügen zu verschonen. Die Generäle der kaiserlichen Armeen hielten sich jedoch nicht an diese Order.
Was bis 1641 marodierende Horden oder die kaiserlichen Truppen nicht an sich gebracht hatten, holten sich zu Beginn dieses Jahres die Schweden während ihres Kriegszugs gen Regensburg.
In den beiden darauffolgenden Jahren 1642 und 1643 kam es in der gesamten Oberpfalz - also auch in Pavelsbach - wetterbedingt zu verheerenden Missernten, so dass Hunger und Tod vermutlich ein ständiger Begleiter der Pavelsbacher waren.
Im November 1645 schlug dann Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich mit seinen 16.000 Mann und 57 Geschützen in Pyrbaum sein Hauptquartier auf. Als Unterkunft nutzte der Erzherzog das Schloß zu Pyrbaum.
Hierzu berichtet die Amberger Regierung in einem Schreiben, dass die disziplinlose Truppe des Erzherzogs Leopold Wilhelm in der gesamten Gegend - also auch in Pavelsbach - alle essbaren Lebensmittel geraubt, das Vieh geschlachtet, das Getreide mitgenommen oder verfüttert haben. Sie haben "Tisch, Bänk, Fenster, Türen, Pflüge und anderes Geschirr zerschlagen, zerhaut, die hölzernen und strohenen Dächer abgedeckt, die Zimmer abgebrochen, alles Holzwerk verbrannt". Der Berichterstatter kommt zu dem Schluss, dass diese undisziplinierten Völker schlimmer gehaust hätten als die schwedischen Feinde.
Für Pavelsbach existiert eine detaillierte Schadensaufstellung über zerschlagenes Inventar, geraubte Futtermittel und verbrannte Güter die einen Gesamtwert von 59 Gulden und 40 Kreuzer ausmacht. [11/Seiten 95+96]
Zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs -in 1648- waren in Pavelsbach von den ursprünglich 63 Hofstellen nur noch 20 Hofstellen bewohnt und der Ort Kyrstetten (bei der Kappl) vermutlich völlig verwaist.
Eine Aufzeichung der Schäden für den Zeitraum von 1628 bis 1649 zeichnet für Pavelsbach ein ernüchterndes Bild. Die Kriegskosten durch Einquartierungen, Durchzüge und Branschatzungen summierten sich auf 8.860 Gulden (vgl. Heng + Köstlbach 6.677). Die Schäden durch die Schweden machten 8.092 Gulden aus (vgl. Heng + Köstlbach 3.700 Gulden). [11/Seite 99]
Das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" hat in den 30 Kriegsjahren mehr als die Hälfte seiner Bewohner und mehr als zwei Drittel seines Volksvermögens verloren. Die Oberpfalz war sicher weit mehr, als diese Durchschnittswerte aussagen, betroffen. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts erholte sich die Oberpfalz wieder einigermaßen und konnte hinsichtlich Einwohnerzahl, Vermögen und Wirtschaftsleistung jene Werte erreichen, die es vor diesem Krieg aufwies. [11] [12] [13]
Gegenreformation / Auflösung der Pfarrei Pavelsbach: [5] [8]
(von Wolfgang Fries)
In Zuge der Gegenreformation wurde die Oberpfalz ab 1621 von Amberg aus rekatholisiert. Während sich die Städte anfänglich gegen diese neuerliche Änderung wehrten, ging dies auf dem Lande - also auch in Pavelsbach - zügiger und leichter voran, zumal den Bauern der Calvinismus durch Johann Casimir von der Pfalz aufgezwungen worden war. In 1626 wurde im Zuge dieser Bewegung dann auch die bis dahin selbständige, protestantische Kirchengemeinde Pavelsbach aufgelöst und wieder der katholischen Pfarrei Möning zugeschlagen. [5] [8]
Bericht des Schultheißenamts Neumarkt um 1630: [5]
(von Wolfgang Fries)
Dieser um das Jahr 1630 im Auftrag von Kurfürst Maximilian I. von Bayern erstellte Bericht beschreibt die Besitzverhältnisse im Schultheißenamt Neumarkt und der Hofmark Berngau.
Der Zwillingsort Pavelsbach bestand in 1630 - nach 12 Jahren Krieg - noch aus insgesamt 63 Hofstellen, einer Kirche und dem Pfarrhaus, dass vom Mesner bewohnt wurde. 33 Hofstellen Niederpavelsbachs waren danach im Besitz des Deutschordenamts Postbauer. Aus der säkularisierten Klosterherrschaft Seligenporten waren dem bayerischen Kurfürstenhaus der Ort Oberpavelsbach und einige Anwesen Niederpavelsbachs, insgesamt 27 Hofstellen, zugefallen. Dem zu dieser Zeit im Besitz des Pfalzgrafen Johann Friedrich von Pfalz-Hilpoltstein befindliche Debutat Hilpoltstein gehörten 2 Hofstellen. Die Reichsstadt Nürnberg besaß in Pavelsbach eine abgabenpflichtige Hofstelle. [5/Seite 269]
Die Pest von 1634 [81] [125]
(von Wolfgang Fries)
In der Mitte des Dreißigjährigen Krieges rollte eine schwere Pestwelle durch die gesamte Oberpfalz. Ein Chronist aus Pfreimd berichtet davon, dass "die Leute auf der Straße umfielen wie die Fliegen". Hemau verlor in diesem Jahr die Hälfte der Bevölkerung. In Neumarkt wurden Zeitraum vom 07.02.-31.12.1634 467 Pestopfer gezählt. [81/Seite 114] [125/Seite 93] In Freystadt waren fast alle Bewohner gestorben. Es gab kein 10 Männer mehr. [125/Seite 93] Auch Pavelsbach und der Ort Kyrstetten dürften dieser Epedemie nicht entgangen sein.
Niederpavelsbach in 1670 [137]
(von Wolfgang Fries)
Nach einer Beschreibung des Deutschordensamtes Postbauer bestand die Grundherrschaft (Nieder-)Pavelsbachs im Jahre 1670 aus 6 Höfen und 26 Güthlein, also 32 Anwesen [137/Seite 166]
Weiteres zur Kirche St. Cäcilia: [9] [10] [11] [15]
(von Wolfgang Fries)
Nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Kriegs bedurfte die Kappl einer grundlegenden Renovierung. Zur Gewinnung der hierfür notwendigen Baustoffe wurden vermutlich auch Teile der wenigen, seit Ende des Dreißigjährigen Kriegs leerstehenden Wohnhäuser Kyrstettens abgebrochen, auch wenn auf einer Landkarte des Jahres 1748 noch einige Häuser um St. Cäcilia eingezeichnet sind.
Die Einweihung erfolgte dann durch Pfarrer Andreas Lausner am 26.07.1682, dem Fest der hl. Mutter Anna, im Beisein von Neumarkter Vertretern des Kurfürstenhauses (Kastner, Oberheiligenpfleger und Mautner), des Richters des Hochadelsstifts Seligenporten und des Pflegers des Deutschen Ordens zu Postbauer.
Herausgestellt wird in Berichten auch das Engagement des Ulrich Sigert, Wirt in Oberpavelsbach und des Pavelsbacher Heiligenpflegers Johann Krumzer.
In Erinnerung an dieses Ereignis gingen die Pavelsbacher noch bis in die 1960er Jahre am "Anna-Tag" in einer Prozession zur Kappl um einen feierlichen Gottesdienst abzuhalten.
Der bereits genannte Pavelsbacher Wirt Ulrich Sigert (Kesslwiád Hs. Nr. 51) und dessen Ehefrau Magdalena sowie der oben angeführte Pfleger des Deutschen Ordens zu Postbauer, Michael Adelmann, waren es auch, die der Kirche St. Cäcilia in 1695 jeweils einen Seitenaltar gestiftet haben. In dieser Kirche erfährt - neben der Kirchenpatronin St. Cäcilia - v.a. auch der "Pestheilige" Sebastian eine besondere Verehrung. (Weitere Informationen zum Gebäude und dessen Ausstattung siehe Rubrik "Sehenswürdigkeiten"). [9] [10] [15]
Nachgewiesen ist auch ein Pilgerzug aus Neumarkt zur Cäciliakirche im Jahre 1683. Die zahlreichen Teilnehmer waren in ledernen Pilgermänteln und mit Pilgerstäben erschienen. Die Neumarkter Gläubigen brachten als Opfer ein Meßgewand dar. [11/Seite 82]
Wiederherstellung der Klosterherrschaft Seligenporten [5] [8]
(von Wolfgang Fries)
Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern stellte in 1669 die meisten oberpflälzischen Klöster wieder her. Diese bestanden bis dahin zwar organisatorisch weiter, unterstanden aber direkt dem Kurfürsten und wurden jeweils von einem sog. "Klosterrichter" verwaltet.
Das Zisterzienserinnenkloster Seligenporten wurde zwar nicht rekonstituiert, Kurfürst Ferdinand Maria schenkte die früheren Besitzungen des Klosters Seligenporten, darunter auch große Teile der Ortschaft "Oberpavelsbach", in 1692 dem neu gegründeten Salesianerinnenkloster in Amberg. Deren Obrigkeitsrechte wurden von einem bestellten "Klosterrichter" vor Ort wahrgenommen. [5] [8/Seite 8] [137/Seite 149 ff.]
Die pavelsbacher Untertanen des Deutschen Ordens in 1720 [11]
(von Wolfgang Fries)
Für 1720 weist eine Verzeichnis für Niederpavelsbach 42 Hofstellen aus, wobei für 8 Anwesen ausschließlich ein (bloßes) Haus vermerkt ist (Anmerkung: Bestenfalls waren dies also Wohnstallgebäude ohne gesonderte Scheune). Neben den 5 größeren Höfen (bestehend aus Haus, Scheune, Backofen und Brunnen) werden dort noch 29 sog. Gütlein (bestehend aus Haus und Scheune) aufgeführt.
Auch die Namen der jeweiligen Besitzer sind in dieser Unterlage vermerkt. Einige Namen sind heute noch in Pavelsbacher Familien - wenn auch in leicht abgewandelter Schreibweise - vertreten. Zu diesen Familiennamen zählen Diestler, Haubner, Lucas, Riehl und Schmidt. Bekannt bzw. als Hausnamen noch gebräuchlich sind Bschirl, Gerlitz, Geiger, Hirschberger, Kirsch und Schuster. [11/Seiten 108-110]
Güterverzeichnis des Deutschen Ordens 1730 [9]
(von Wolfgang Fries)
Der Ordenspfleger und Rechtsgelehrte Dr. Johann Georg Sartorius erstellte in 1730 im Auftrag des Landkomturs Carl Heinrich von Hornstein ein "Urbar" des Amtes Postbauer.
Für Niederpavelsbach sind dort 43 deutsch-ordische Hofstellen vermerkt. Damit war das Pavelsbacher Unterdorf für das Deutschordensamt Postbauer eines der wichtigsten (der über 17 Ortschaften verteilten) Güter und wurde nur von Schwarzach mit 46 Hofstellen übertroffen.
Von den Niederpavelsbachern wurden jedoch nur 7 Höfe bewirtschaftet, die als "Vollbauernstellen" galten. Nähere Informationen liegen zu einem der größten Höfe Niederpavelsbachs vor, der am "Hirtengässel" (heute vermutlich Ottostraße) gelegen war.
Der Hof dieses Hannß Haffner bestand aus Haus (~Wohnstallhaus), Stadel und daran angebauten Schweineställen, Wagenschupfen, Backofen und Brunnen und verfügte über 5 1/2 Tagwerk Wiesen und 26 1/2 Tagwerk Felder. An Abgaben musste er 33 1/2 Metzen Hafer an den Deutschen Orden liefern und den Haus- und Feldzehnt an das Kloster Seligenporten leisten, dass zu dieser Zeit bereits von den Salesianerinnen aus Amberg verwaltet wurde.
Darüber hinaus waren die "Vollbauern" Niederpavelsbachs verpflichtet, die unmittelbar vom Orden bewirtschafteten Felder zu beackern sowie den Transport des Brennholzes zu besorgen.
Bei der weit überwiegenden Mehrheit (35 Stück) der Unterdorfer Anwesen handelte es sich um sogenannte Köbler (Kleinstbauern), die wesentlich kleinere Flächen bewirtschafteten. Beispielhaft sei hier der Köbler Hannß Pröbster genannt, der Haus, Stadl, Schupfen und Brunnen sowie zwei kleine zehntfreie Gärtlein und 1 1/2 Tagwerk Felder besaß. Hierfür musste er jährlich 2 Metzen Hafer an den Deutschen Orden abgeben. Außerdem erhielt das Kloster Seligenporten den Getreidezehnt, währen der Haus- und Schmalzehnt dem Pfarrer von Möning zustand, der Pavelsbach zu dieser Zeit als Filiale versah. (Anmerkung: Überleben konnten diese Kleinstbauern nur, durch die Mitnutzung der Allmende. In Pavelsbach waren dies vor allem Am Esper [= "die Hoi"], die Au-Wiesen und der Schacha [= Waldstück]).
Die 35 Unterdorfer Köbler mussten dem Pflegamt, soweit sie über Zugtiere verfügten, auch Pflugfronen leisten. Die noch ärmeren Kleinbauern ohne "Anspann" hatten die Mahd festgelegter Wiesen-stücke zu besorgen oder mussten einen Tag bei der Getreideernte des Deutschen Ordens helfen.
Lediglich Johannes Baumeister, der Inhaber der Pavelsbacher Badestube (Boodá - späteres Wongà-Anwesen Hs. Nr. 57), war scharwerksfrei und zahlte als Abgabe 24 Kreuzer Zins an die Deutschordenskommende Nürnberg. [9/Seiten 72+73]
Wie betreffende Recherchen des Ortsheimatpflegers Josef Lobenhofer gezeigt haben, bestand Pavelsbach um 1730 aus insgesamt 78 Answesen. [138] Auf das Oberdorf entfielen dabei 24 Höfe sowie ein Hütehaus. Das Unterdorf bestand aus 52 Anwesen und ebenfalls einem Hütehaus. Das Schul- und Mesnerhaus war gemäß der Stiftungsurkunde aus 1438 von allen Grundabgaben befreit. Neben den 43 "deutschordischen" Hofstellen (ausschließlich im Unterdorf) gab es zu jener Zeit u.a. 31 Anwesen, die dem Kloster Seligenporten als Grundherrn zuzurechnen waren (dav. alle 25 Anwesen des Oberdorfs).
Darüber hinaus gab es im Unterdorf noch drei Höfe, die von der Pfalzgrafschaft Pfalz-Neuburg abhängig waren und eine Hofstelle, die zur Hofmark Woffenbach gehörte. [138]
Neubau der Kirche zu Pavelsbach (1735-1736): [1] [16] [27]
(von Wolfgang Fries)
Nachdem das 1438 errichtete Gotteshaus - nach dreihundert Jahren - "ruinös und baufällig" geworden war, musste es in 1735 großteils abgetragen und durch einen Neubau ersetzt werden.
Noch in diesem Jahr wurde mit dem Abbruch des Langhauses und des Turms begonnen; nur der Chorraum und die Hauptmauern blieben stehen.
Der für die Filialkirche Pavelsbach zuständig Möninger Pfarrer Johann Michael Schilcher schreibt am 25. April 1735 in einem Bericht an das Eichstätter Generalvikariat davon, dass sich die Baumaßnahme verzögert, da sich die Salesianerinnen von Amberg (als Grundherrn Oberpavelsbachs) längere Zeit weigerten, einen angemessenen Anteil der Baukosten zu übernehmen (Siehe Diözesanarchiv Eichstätt, Pfarrakte Möning I/6).
Im Jahre 1736 konnte der Neubau dann schließlich vollendet werden. Ein Beleg hierfür ist auch eine im Dachstuhl eingelassene Jahreszahl.
Wohl in den Jahren 1737 und 1738 wurde das Innere der neuen Kirche St. Leonhard mit barocken Stukkaturen (vermutlich von Donato Polli) und 23 Fresken geschmückt (Weitere Informationen zum Gebäude und dessen Ausstattung siehe Rubrik "Sehenswürdigkeiten") [1]
Pavelsbach und der Polnische Erbfolgekrieg [11] [93] [129]
(von Wolfgang Fries)
Im Rahmen dieser kriegerischen Auseinandersetzung marschierten große Truppenverbände mehrerer europäischer Herrscher auch durch unsere Heimat. Im Sommer 1735 genehmigte der deutsche Kaiser Karl VI. u.a. den Durchmarsch Russischer Truppen über deutsches Reichsgebiet. [93] Diese unter dem Kommando des Feldmarschalls Peter Graf von Lacy (Pjotr Petrowitsch Lacy) [129] stehende 11.500 Mann starke Armee diente der Verstärung der von Frankreich bedrohten Neckarfront. Mit Waffenstillstandsvereinbarung vom 11. November 1735 wurden dort die Kampfhandlungen dann eingestellt. [93]
Am 08. und 09. Januar 1736 mussten die Pavelsbacher (auf kaiserlichen Befehl hin) eine Kompanie des Woronizischen-Infantrie-Regiments beherbergen. Diese Truppe, die der oben genannten russischen Armee angehörte, befand sich auf dem Rückmarsch vom Rhein nach Russland. [11/Seite 102]
Für die Pavelsbacher bedeutete dies, dass sie den Soldaten in den kalten Wintertagen und -nächten des Jahres 1736 nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Proviant unentgeltlich zu stellen hatten. Darüber hinaus mussten die Einwohner Pavelsbachs die Zugtiere der Begleitfahrzeuge unterstellen und mit Futter versorgen.
Landkarte von 1748 [57] (von Wolfgang Fries)
Auf der Landkarte des Herrschaftsgebiets Sulzbürg und Pyrbaum aus dem Jahre 1748 wird neben "Babelsbach" die Kappl (St. Cecilien) noch als Dorf mit Kirche ausgewiesen, obwohl vermutlich die Reste der dortigen dörflichen Bebauung um 1680, im Rahmen des Wiederaufbaus der Kirche St. Cäcilia, zur Gewinnung der hierfür notwendigen Baustoffe abgebrochen wurden.
Kirchenraub in Pavelsbach [16] [110] (von Wolfgang Fries)
In der Nacht vom 12. auf den 13.10.1758 wurde in die Kirche und die Sakristei der Pavelsbacher Kirche eingebrochen. Die Kirchenräuber eigneten sich einen silbernen Kelch, ein kupfernes Ziborium samt Mäntelchen (Ziboriumvelum) und eine Leonhardi-Reliquienmonstranz an. Die konsekrierten Hostien wurden von den Einbrechern in der Kirche ausgeschüttet. [16]
Bei den Dieben dürfte es sich um einen Vorläufer der Großen Fränkischen Diebes- und Räuberbande gehandelt haben, die im augehenden 18. Jahrhundert vor allem in Franken und in der Oberpfalz ihr Unwesen trieb und nachweislich auch Kirchen ausraubte. [110]
Ein Eremit aus Pavelsbach [147] (von Wolfgang Fries)
Der aus Pavelsbach - vermutlich aus Hs.Nr. 59 - stammende Rochus Buchner bezog im Jahre 1762 die Eremitage des Maria-Hilf-Kirchleins zu Lengenbach (bei Deining). Als Gegenleistung für dieses Privileg verpflichtete sich Rochus Buchner, der Jugend Lengenbachs das Lesen und Schreiben beizubringen. [147]
Französische Revolution [149] (von Wolfgang Fries)
Am 14. Juli 1789 stürmten die Bürger von Paris die Bastille, eine besonders befestigte Stadttorburg, die zu jener Zeit als Staatsgefängis genutzt wurde.
Die Einwohner Pavelsbachs dürften von diesem geschichtlichen Schlüsselereignis zunächst wohl keine Kenntnis erlangt haben. [149]
Die erste Pavelsbacher Orgel [17] [150]
(von Wolfgang Fries)
Die Kirche St. Leonhard wird im Jahre 1792 mit einer ersten Kirchenorgel ausgestattet. [17/Seite 169] Dies ist besonders bemerkenswert, zumal in diesem Jahr die Bevölkerung durch den Ausbruch des Ersten Koalitionskriegs gegen das revolutionäre Frankreich erheblich belastet wurde. Als Folge dieser bis 1797 andauernden kriegerischen Auseinandersetzung mussten die deutschen Fürsten im Frieden von Campo Formio ihre linksrheinischen Gebiete an Frankreich abtreten. [150]
Säkularisation, Mediatisierung und Franzosenzeit in Pavelsbach: [8] [9] [11] [89] [105] [114] [115] [151] [152] [153] (von Wolfgang Fries)
Mit dem am 25. Februar 1803 im Alten Rathaus von Regensburg gefassten Reichsdeputationshauptschluss wurde die rechtliche Grundlage für die anschließende Säkularisation und Mediatisierung gelegt. [105]
Copyright zum Foto: CC BY-SA 4.0 Bärwinkel, Klaus (Altes Rathaus in Regensburg, links die Neue-Waag-Gasse)
Im Reichsdeputationshauptschluss wurde festgesetzt, dass die weltlichen Fürsten für ihre linksrheinischen Gebietsverluste - an das napoleonische Frankreich [114] - abgefunden werden. [105]
Dies sollte durch die Säkularisation kirchlicher Herrschaftsgebiete und durch Mediatisierung von kleineren weltlichen Herrschaften der bisherigen Reichsstände rechts des Rheins geschehen. Als Folge der Mediatisierung wurden insgesamt 2 Kurfürstentümer, 9 Hochstifte (auch das Hochstift Eichstätt), 44 Reichsabteien und 45 Reichsstädte aufgelöst. Das hatte zur Folge, dass 45.000 km² Ländereien und fast 5 Millionen Menschen neue Landesherren erhielten. [105]
Oberpavelsbach, dass bis dahin im Besitz der Amberger Salesianerinnen war, fiel auf Basis dieses Reichsgesetzes am 02.03.1804 dem Bayerisch-Wittelsbachischen Kurfürstenhaus zu. [8]
Niederpavelsbach mit seinen 50 deutschordischen Anwesen [89] (und damit auch die Kirche St. Cäcilia, die sich bis 1805 auf dem Grundbesitz der "Deutschherren zu Postbauer" befand) wurde wenig später -am 11.01.1806- Teil des am 01.01.1806 proklamierten Königreichs Bayern. [9] [89] [153]
Um einer bevorstehenden Einverleibung durch Österreich zu entgehen, schloß Bayern mit dem französischen Kaiserreich bereits in 1805 insgeheim eine Militärallianz (Bogenhausener Vertrag) und trat dann im Juli 1806 dem Rheinbund bei. [115] [151] In der Folgezeit musste Bayern dem französischen Kaiser 20.000 Soldaten stellen. [152] Auch in Pavelsbach wurden in der Folgezeit immer wieder französische Truppen einquartiert. [11/Seite 142] Die hierdurch stark belastete Bevölkerung war daher auf Napoleon Bonaparte und "die Franzosen" nicht besonders gut zu sprechen.
Pavelsbach und der Vierte Koalitionskrieg [11] [109] (von Wolfgang Fries)
Während des französichen Aufmarschs in Vorbereitung des Feldzugs von 1806 [109] bezogen im Mai das 8. und später das 21. französische Dragonerregiment in Neumarkt und Umgebung Quartier. Da diese Truppen hinsichtlich Wohnung, Kost und Kleidung hohe Anforderungen stellten, war man allgemein froh, als sie am 22.09.1806 in den Krieg gegen Preußen und Rußland - dem vierten Koalitionskrieg - abrückte. [11/Seite 142]
Pavelsbach und der Fünfte Koalitionskrieg [11] [111] [112] [113] [158]
(von Wolfgang Fries)
Der 5. Koalitionskrieg [111], der durch den Einmarsch Österreichischer Truppen in Bayern ausgelöst wurde, wütete zunächst in der Oberpfalz (Schlacht bei Regensburg). Wie eine Karte des "Department of History" der "United States Military Academy" zeigt, war vom Aufmarsch des aus Hannover herangeführten, 63.000 Mann starken Corps Davout auch unsere Gegegend betroffen. [158] Nach der Einnahme Wiens durch französische Truppen und dem Friedensschluss von Schönbrunn, nahm in 1810 das 48. Infantrie-Regiment des französichen Corps Davout [112] in der Stadt Neumarkt und deren Umland Quartier. [11/Seite 142]
Auch Pavelsbach musste in dieser Zeit Quartiere für die Soldaten dieses Regiments stellen und für deren Verpflegung sorgen. Wie den Matriceln der Pfarrgemeinde Pavelsbach aus 1811 bzw. 1845 zu entnehmen ist, blieb der Aufenthalt der französischen Grenadiere für Pavelsbach nicht ohne Folgen. Am 17.02.1811 wurde in Hs.Nr. 4 der kleine Johann geboren. In den Taufmatriceln Pavelsbachs wird als dessen Vater "Frz. De Sabre - Grenadier" aufgeführt. Nochmals erscheint bei Heirat des Johann Deßaber am 22.04.1845 der Hinweis auf seinen Vater "Franz Deßaber franz. Grenadier" in den Trauungsmatriceln Pavelsbachs. [113/Taufen 1780-1812 Nr. 04.0093 / Trauungen 1812-1857 Nr. 07.0126]
Ob der französische Grenadier Franz De Sabre jemals erfahren hat, dass er in Pavelsbach einen Sohn gezeugt hat, ist leider nicht überliefert. Sein Name jedoch lebt in Pavelsbach bis heute im Hausnamen "Dessawá" fort.
Pavelsbach und der Deutsche Bund [154] (von Wolfgang Fries)
Die Gründung des Deutschen Bundes erfolgte im Rahmen des Wiener Kongresses. Die Deutsche Bundesakte vom 08.06.1815 ist daher ein Teil der Wiener Kongressakte. Mit Bayern gehörte auch Pavelsbach diesem Staatenbund an. Sitz der Bundesversammlung war der Palais Thurn und Taxis in Frankfurt. [154]
Die Gemeinde Pavelsbach entsteht [14] [15]
(von Wolfgang Fries)
Im Zuge einer ersten Verwaltungsreform (Erstes Gemeindeedikt des Königs Maximilian I. Josef von Bayern vom 28. Juli bzw. 24. September 1808 mit nachfolgenden Verordungen) wurden zunächst die bereits bestehenden (Liegenschafts-)Kataster und die Landgerichte in Steuerdistrikte sowie Gemeinden eingeteilt.
Mit dem zweiten Gemeindeedikt vom 17. Mai 1818 wurden die gemeindlichen Selbstverwaltungen wieder hergestellt. Ihre Aufgaben waren nunmehr wieder die Verwaltung des Gemeinde- und Stiftungsvermögens (Hütehäuser, Grundstücke, Weiderechte usw.), Führung eines Standes- und Melderegisters, Mitwirkung bei der Zuslassung von Gewerben und gewisse Zuständigkeiten in der Kirchenverwaltung und im Volksschulwesen.
Somit ist der 17.05.1818 der "Gründungstag" der Gemeinde Pavelsbach.
Auch in Pavelsbach war der Gemeindeausschuss mit dem Gemeindevorsteher (Hauptorgan) an seiner Spitze, dem Gemeindepfleger, dem Stiftungspfleger und drei bis fünf besonderen Gemeindebevollmächtigten für die Verwaltung zuständig.
Die Mitglieder des Gemeindeausschusses wurden - wie überall in Bayern - von der "versammelten Gemeinde" (Gemeindeversammlung der Einwohner mit Bürgerrecht) aus ihrer Mitte gewählt, wobei nur Männer über das aktive und passive Wahlrecht verfügten, die in Pavelsbach eine besteuertes Gewerbe ausübten oder dort einen besteuerten Haus- oder Grundbesitz hatten (somit waren sämtliche Frauen und auch die männlichen Dienstboten vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen).
Gemäß dem zweiten Gemeindeedikt sollten die wichtigsten Gemeindeämter nur mit Personen besetzt werden, die zum Kreis der Höchstbesteuerten gehörten (Anmerkung des Autors: Somit eine weitere Beschränkung des passiven Wahlrechts auf vermögende Einwohner). Die Gemeindeversammlung hatte nur beratende Funktion und damit nur sehr begrenzten Einfluss.
Die Gemeinde bzw. der Gemeindeausschuss wurde jedoch von den Landgerichten, als untere Verwaltungsbehörden (ab 1862 von den neu geschaffenen Bezirksämtern), beaufsichtigt. In Falle von Pavelsbach war dies das Bezirksamt Neumarkt. [14]
Bereits 1834 verfügte Pavelsbach über eine eigene "Gemeindebürgersatzung", die die Rechte und Pflichten der in Pavelsbach beheimateten Bürger regelte. Danach wurde von jedem volljährigen (21 Jahre) Pavelsbacher, der obige Voraussetzungen erfüllte, eine jährliche Steuer von mindestens 10 Gulden eingezogen. Höhere Steuerbeiträge wie beispielsweise 30 Gulden sicherten dann 3 Stimmrechte für den betreffenden Bürger. [15]
Der erste Pavelsbacher Musiker [26] (von Wolfgang Fries)
In 1824 erwähnt eine Dorfchronik erstmals den Klarinettisten Johann Fries (geb. am 23.08.1794 in Hs.Nr. 4 / ab 03.06.1824 wohnhaft Hs.Nr. 48) und einige leider nicht namentlich genannte weitere Musiker. Näheres hierzu ist der Rubrik "Vereine" zu entnehmen. [26] Bild: 5-Klappen-Klarinette, um 1800 aus der Sammlung des Christian Ledermann.
Bildnachweis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klarinette-Griessling-Schlott.jpg / Copyright: CC BY-SA 4.0
Dem Autor haben verlässliche Quellen berichtet, dass Johann Fries, sein Sohn Sebastian und sein Enkel Jakob mit einer rötlichen 5-Klappen-Klarinette musiziert haben.
Hagelsturm über Pavelsbach [27] [79] (von Wolfgang Fries)
Am 12.09.1828 - zwischen 17 und 18 Uhr - ging über Pavelsbach und dessen Umgebung ein schweres Hagelwetter nieder. Die Eisklumpen wiesen ein Gewicht von bis zu 1 1/2 Pfund auf!!! Es wurde eine Vielzahl von Pavelsbacher Hausdächern schwer beschädigt. Auch das Dach der St.-Leonhard-Kirche wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiederherstellung des Kirchendachs verursachten Kosten in Höhe von 300 bayerische Gulden (dies entsprach damals 3 durchschnittliche Jahreseinkommen eines Handwerksgesellen), ein immenser Betrag für Pavelsbach. [27] [79]
Großbrand im Unterdorf [27] [79] [100] (von Wolfgang Fries)
Beim Gütler Leonhard Lachenschmidt (Hs.Nr. 7 / Liál / heute Simonstr. 13) brach am 29.06.1829 zwischen 5 und 6 Uhr abends ein Feuer aus. Was dieses Feuer ausgelöst hat ist nicht bekannt.
Da es noch keine leistungsfähige Feuerwehr in Pavelsbach gab und sich vermutlich ein Teil der Bevölkerung auf den Feldern oder auf dem Weg heimwärts befand, konnte sich dieser Brand auf 14 Wohnhäuser und 8 Nebengebäude ausbreiten. Besonders tragisch war, neben der großen materiellen Verluste, der Feuertod des fünfjährigen Knaben Mayer Andreas beim Wewámichl (Hs.Nr. 6). [27] [79] [100]
Renovierung der Kirche St. Leonhard [17] (von Wolfgang Fries)
Aus Mitteln der Kirchenstiftung wurde in 1831 die Kirche St. Leonhard einer Renovierung unterzogen. Es fielen hierfür Kosten in Höhe von 491 Gulden an. [17/Seite 170]
Eine erste Primiz in Pavelsbach [119] (von Wolfgang Fries)
Am 24.09.1834 fand in Pavelsbach eine erste Primiz statt. Der am 21.03.1806 geborene Johann Baptist Gerlitz (Hs. Nr. 14) feierte diese unter freiem Himmel bei der Kirche. Die Gäste wurden dann beim Neuwirt (Hs Nr. 67) ausgespeist (weitere Details siehe Rubrik Pfarrgemeinde).
Wahl 1835 [15] (von Wolfgang Fries)
Der erste Gemeindausschuss sowie der erste Ortsvorsteher Meyer Michael oder Johann (Hofnáfriel Hs. Nr. 34 - genaueres ist nicht bekannt) werden gewählt.
Die zweite pavelsbacher Primiz [119] (von Wolfgang Fries)
Am 01.01.1937 fand dann die Primiz des Johann Baptist Fries (Hs. Nr. 1) statt. Festprediger war der Hochwürdige Herr Pfarrer Schwarzberger aus Berngau (weitere Details siehe Rubrik Pfarrgemeinde).
Wahl 1837 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindausschuss sowie der neue Ortsvorsteher Schmidt Michael (Schbidsn Hs. Nr. 24) werden gewählt.
Wahl 1847 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Ortsvorsteher Hirschberger Peter (Schmiebauàn Hs. Nr. 66) werden gewählt.
Deutsche Revolution 1848/1849 und Wahlen 1848 zur Nationalversammlung [123] (von Wolfgang Fries)
Anders als in den Metropolen des Deutschen Bundes verhielten sich die Oberpfälzer in dieser revolutionären Zeit eher ruhig. Für Neumarkt sind nur vereinzelte Rufe nach mehr Freiheit belegt.
Am Dienstag den 25. April 1848 fanden in Bayern die Wahlen zur ersten Deutschen Nationalversammlung statt. Im königlichen Landgerichtsbezirk Neumarkt gehörte Pavelsbach mit seinen 439 Seelen dem Urwahlbezirk VII an. Wie der nebenstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, zählte Pavelsbach in 1848 mehr Einwohner als Postbauer und Heng zusammen.
Mit dieser Urwahl wurden (wie noch heute in den USA) zunächst nur Wahlmänner ermittelt. Drei Tage später versammelten sich die Wahlmänner des Wahlbereichs Neumarkt und wählten den in Bamberg tätigen Prälaten Leonhard FRIEDRICH zum Abgeordneten des Landgerichtsbezirks Neumarkt. [123]
Ab dem 18. Mai 1848 vertrat er als fraktionsloser Abgeordneter des "Wahlkreis 2 Oberpfalz" dann u.a. die Interessen der Pavelsbacher in der Nationalversammlung, die in der Paulskirche zu Frankfurt zusammen trat. [123]
Reparatur des Schul- und Mesnerhauses [17] (von Wolfgang Fries)
Das ursprünglich in der heutigen Leonhardstraße befindliche Schul- und Mesnerhaus wurde in 1849 einer umfangreichen Reparatur unterzogen. Die Kosten in Höhe von 510 Gulden wurden jeweils hälftig von der Gemeinde Pavelsbach und der Kirchenstifung St. Leonhard getragen. [17/Seite 171]
Kreuzwegzyklen für die beiden Kirchen [17] (von Wolfgang Fries)
Für die beiden Kirchen St. Leonhard und St. Cäcilia wurden in 1850 jeweils ein Kreuzwegzyklus angeschafft. Die insgesamt 28 Gemälde stammten aus der Werkstatt des Kunstmalers Franz Xaver Kleiber aus München, dessen bekanntestes Werk "König Maximilian I. Joseph von Bayern im Krönungsornat" noch heute im Münchener Stadtmuseum zu sehen ist. [17/Seite 171] Bildnachweis: CC BY-SA 4.0 / Münchner Stadtmuseum Sammlung Online / Lizenz gem. Weiterverwendung
Wahl 1860 [15] (von Wolfgang Fries
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Ortsvorsteher Muschaweck Josef (Kiáschn Hs. Nr. 46) werden gewählt.
Der "Physikatsbericht" für Neumarkt und Umgebung aus dem Jahr 1860 [131] [148] (von Wolfgang Fries)
Auf Veranlassung von König Maximilian II. Joseph von Bayern wurden am 21.04.1858 die Amtsärzte aller bayerischen Landgerichtsbezirke aufgefordert, umfassend über ihren Amtsbezirk zu berichten. Nachstehend einige, interessante Feststellungen des neumarkter Amtsarztes Franz Seraph Schwenninger vom 31.12.1860, die auch auf Pavelsbach zugetroffen haben dürften:
Einwohnerzahl: (Anmerkung: Der damalige Landgerichtsbezirk Neumarkt umfasste die heutigen Gemeinden/Märkte/Städte Neumarkt, Deining, Mühlhausen, Freystadt, Sengenthal, Berngau, Pyrbaum und Postbauer-Heng) Der Landgerichtsbezirk Neumarkt ist Heimat von 18.476 Seelen [131/Seite 112]. (Anmerkung: Der Markt Allersberg mit seinen damals rd. 1.550 Einwohnern gehörte zwischen 1862 und 1880 ebenfalls zum Bezirksamt Neumarkt). [148].
Sterblichkeit [131/Seite 115]: Rund 50 % der Kinder starben bis zum 5. Lebensjahr.
Wohnverhältnisse [131/Zitat in Auszügen Seite 121+122]: Die Wohnhäuser der Landbevölkerung sind größtenteils einstöckig und enthalten in der Regel eine Wohnküche, öfter auch ein Austragsstübchen, Kammer, Küche und Stallung. .... Die Kammern, meistens finstere, dumpfe, feuchte Räume, pflegen als Schlafgemach für die Bauersfamilie zu dienen. Außer einem Ehebett und den kleineren Schlafstellen für die Kinder, Wiegen etc. dient die Kammer zum Aufbewahrungsort für gar mancherlei Gegenstände - ein Kleiderkasten, ein Tisch, meist auch zum Waschen (nicht der Bauersleute, sondern der Wäsche), der Vorrat Brot und Milch, nicht selten geräuchertes Fleisch, Kartoffel und zum Überflusse zuweilen das Krautfass - finden hier ihre Unterkunft und mengen ihre Dünste zur Kammerluft. ... Die Küche ist meist finster und ihre Wände sehen gewöhnlich aus, wie geteert.
Beschäftigung [131/Seite 113]: 85,5 % der Gesamtbevölkerung des Bezirkes sind zu den Landwirten zu rechnen.
Reinlichkeit [131/Zitat in Auszügen Seite 138+139]: Reinlichkeit gehört keineswegs zu den Tugenden unserer Bevölkerung. ... Kaum jedesmal an Sonn- oder Festtagen, geschweige an den Werktagen kämmen sich die Weiber das Haar. Aus dem Bette gestiegen, fassen sie es mit den Händen zusammen, drehen es zu einem Schopf und binden darüber das Kopftuch. ...... Wie es mit der Leibwäsche aussieht, läßt sich nicht erraten, wenn man Gelegenheit hatte, die Haut halt einmal in weiterem Umfange zu überblicken, nicht selten überzogen wie von einer Schicht Dammerde, auf der Rübsaamen haften könnte. .... Und wie im Hause, so herrscht Unordnung und Schmutz außer dem Hause, da liegen der Düngerhaufen vor der Türe und die Gülle läuft im Hofe nach Willkür herum. ... Wehe dir Wanderer, wenn du an regnerischem Tage nicht wohlbestiefelt durch dick und dünn zu waten gelernt hast! Wehe dir, wenn dein Geruchsorgan empfindlich ist gegen die rauhesten Dünste, welche aus den stagnierenden Odelbächen aufsteigt.
Deutscher Krieg und Auflösung des Deutschen Bundes [98] [99] [106]
(von Wolfgang Fries)
An der Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich war Bayern, als Mitglied des Deutschen Bundes, indirekt beteiligt. Trotz aller Friedensbemühungen des bayerischen Monarchen König Ludwig II., mussten auch bayerische Truppen auf Seiten Österreichs kämpfen. [98]
Nachgewiesen ist, dass Siegert Josef (Kesdlá Hs. Nr. 63 / 1844-1929) an diesen Kriegshandlungen und womöglich auch an den Kämpfen vom 25. und 26. Juli 1866 bei Uettingen teilnahm. [106] Als Kriegsveteran dürfte er auch ein "Bayerische Armee-Denkzeichen" erhalten haben, wie es hier abgebildet ist. Das im Archiv des Marktes Postbauer-Heng befindliche Stück ist leider nicht ganz vollständig (es fehlt das blau-weiße Ordensband).
In der Folge wurde der Deutsche Bund aufgelöst. Preußen und seine Bundesgenossen gründeten im August 1866 den Norddeutschen Bund als Militärbündnis. Bayern musste mit dem Norddeutschen Bund ein Schutz- und Trutzbündnis abschließen. [99]
Pavelsbach wird in 1867 Expositur [19] [80] (von Wolfgang Fries)
Am 18.07.1867 errichtete Bischof Franz Leopold Freiherr von Leonrod die Expositur Pavelsbach. Der Bauplatz für das Expositurhaus wurde von den Eheleuten Michael und Sabina Ochsenkehl (Hs.Nr. 65 Maddásbauán) gestiftet. [19] Das Sammeln der notwendigen Stiftungsgelder in Höhe von 5.130 Gulden (für die Expositurstiftung) zog sich bis Mitte 1869. Im September 1869 erhielt die Gemeinde Pavelsbach (über das Bezirksamt Neumarkt) die "landesherrliche Bestätigung" zur Errichtung der Expositurstiftung Pavelsbach. [80] In 1870 hat die Gemeinde Pavelsbach dann das Expositurhaus errichtet. [19]
"Mit großer Freude holte die ganze Expositurgemeinde den ersten Expositus (Karl Pfaller) an einem regnerischen Novembertag 1870 von Seligenporten (dort war Karl Pfaller Pfarrprovisor) in feierlicher Prozession mit Kreuz und Fahne und Himmel ein." [19]
Reparatur der Orgel [17] (von Wolfgang Fries)
Die in 1792 eingabaute Orgel bedurfte in 1868 einer grundlegenden Reparatur. Die Firma Bittner aus Nürnberg führte diese Arbeiten aus. Bezahlt wurde der Orgelbauer aus Mitteln der Kirchenstiftung. [17/Seite 169]
Die Gemeindeordnung von 1869 [53] (von Wolfgang Fries)
Mit der Gemeindeordnung von 1869 wurden neue rechtliche Grundlagen geschaffen. Anstelle der bisherigen staatlichen Vormundschaft trat die Rechts- und Fachaufsicht durch das Bezirksamt Neumarkt im genau definierten Wirkungskreis. Im eigenen Wirkungskreis erhielt die Gemeinde Pavelsbach die Allzuständigkeit. Hierzu zählte insbesondere das Heimatrecht als Grundlage der Armenpflege.
Auch wurden offiziell einige Beschränkungen des Wahlrechtes - allerdings nur für Männer - abgeschafft und die Vergabe des Bürgerrechtes nicht mehr alleinig von Grundbesitz oder der Ausübung eines Gewerbes abhängig gemacht.
Stattdessen konnte (nicht: musste) das Bürgerrecht von der Gemeinde verliehen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt waren:
- männlich und volljährig
- Selbständigkeit (Kinder, Dienstboten und Gehilfen in der Hausgemeinschaft galten als unselbständig)
- Steuerveranlagung in der Gemeinde (Grundsteuer oder Gewerbesteuer oder Einkommensteuer)
Wenn diese Bedingungen erfüllt waren, hatten Personen mit Heimatrecht in Pavelsbach oder Personen, die seit mehr als zwei Jahren in Pavelsbach gewohnt und Steuern gezahlt hatten, einen grundsätzlichen Anspruch auf das Bürgerrecht und damit auch das aktive und passive Wahlrecht.
Aber auch wenn alle vorgenannten Bedingungen von vielen Pavelsbachern erfüllt werden konnten, blieb am Ende noch die eigentliche Schwelle zum Erwerb des Bürgerrechtes, dass die Gemeinde befugt war, die Verleihung des Bürgerrechtes von der Bezahlung einer Gebühr abhängig zu machen (genannt werden 12 bis 48 Gulden).
Zwar bildete diese Gebühr eine mögliche Einnahmequelle der Gemeinde, für viele Einwohner Pavelsbachs bedeudetet dies jedoch ein Vielfaches des Monatslohnes (in manchen Fällen wohl ein Jahreslohn). In der Folge wurden Bürgerrechte (und damit auch das Wahlrecht) vorrangig an wirtschaftlich leistungsfähige und/oder vermögende Einwohner Pavelsbachs verliehen. [53]
Wahl 1870 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Bürgermeister Klinger Michael (Frielbauá Hs. Nr. 22) werden gewählt.
Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871 [51] [59]
(von Wolfgang Fries)
Am 16. Juli 1870 befahl der bayerische König Ludwig II. die Mobilmachung der Bayerischen Armee. Aus Pavelsbach eilten 4 junge Männer zur Fahne. Dies waren Lukas Josef (Hs.Nr. 45) und Stadlbauer Johann (Hs.Nr. 23) sowie die Brüder Siegert Josef und Johann Michael (Hs.Nr. 63).
Letzterer musste in diesem Krieg sein Leben geben. Zu seinem bleibenden Gedenken ließen seine Eltern Joseph und Margaretha an der Kirche St. Cäcilia eine Tafel anbringen. Weiteres hierzu siehe auch HTV.
Im Anschluss an diese kriegerische Auseinandersetzung wurden in den deutschen Ländern verschiedene Spottlieder auf Frankreich und dessen Kaiser Napoleon III. gesungen.
Eines dieser Spottlieder -> der Napoleon <-, dass vermutlich nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 entstanden ist (im Text wird u.a. die Schlacht bei Wörth genannt), wurde vor allem von den Gebrüdern Sturm aus Seligenporten bis in unsere Tage weitergetragen. Insbesondere der spätere Bürgermeister von Heng - Sturm Josef - war hier engagiert. [15/Seite 184]
Noch heute wird dieses Lied auch von der Blaskapelle Pavelsbach gespielt und gesungen.
Gründung des Deutschen Reichs 1871 [52] (von Wolfgang Fries)
Mit der Proklamation vom 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses Versailles und der Inkraftsetzung der Reichsverfassung am 16. April 1871 wurde das Königreich Bayern und somit auch Pavelsbach ein Teil des Deutschen Reiches. Aufgrund der in der Verfassung festgehaltenen Reservatrechte des Königreichs Bayern änderte sich für die Pavelsbacher zunächst wenig.
Bahnstrecke Neumarkt-Nürnberg wird eröffnet [15] [38]
(von Wolfgang Fries)
Am 01. Dezember 1871 wurde das Teilstück Nürnberg-Neumarkt der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg eröffnet. Die königlich privilegierte Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen haben hierfür 1869 mit den Planungen und bereits 1870 mit den Bauarbeiten ab Nürnberg in Richtung Regensburg begonnen.
Über den neuen Bahnhof in Postbauer konnte die pavelsbacher Bevölkerung in nur 60 bis 90 Minuten (ab Postbauer) nach Nürnberg fahren. Ein Pferdefuhrwerk benötigte für die gleiche Strecke ca. 7 Stunden!
Ebenfalls in 1871 wurde von der Gansbrauerei Neumarkt die Bahnhofsgaststätte in Postbauer errichtet.
Neubau des "Großen Schulhauses" 1880/1881 [34]
(von Wolfgang Fries)
Auf einem von der Expositur Pavelsbach erworbenen Grundstück errichtete die Gemeinde Pavelsbach in den Jahren 1880 bis 1881 ein neues großes Schulhaus mit Lehrerwohnung im Erdgeschoß und einem Nebenbau inklusive Schultoiletten (weitere Details inklusive Bauplan siehe "Schule").
Wahl 1884 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Bürgermeister Wild Georg (?) (Gra+málá Hs. Nr. 43) werden gewählt.
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Pavelsbach [22] [85]
(von Wolfgang Fries)
Am 06.04.1884 wurde die Wehr gegründet und mit diesem Datum auch als Mitglied des Landes-Feuerwehr-Verbands eingetragen.
Auf Einladung des Bürgermeisters Wild (Hs. Nr. 43) haben sich am Sonntag den 20.04.1884 dann alle 41 Vereinsmitglieder im Hollandschen Gasthof (Kesslwiád Hs. Nr. 51) zu den Vorstandswahlen eingefunden.
Als erster Vorstand wurde der Gastwirt Holland Xaver (Hs. Nr. 51) und als erster Hauptmann (Kommandant) wurde der Bader Baumeister Josef (Hs. Nr. 57) gewählt.
Allerdings hielt sich das ehrenamtliche Engagement der Pavelsbacher anfänglich in sehr engen Grenzen. Vermutlich im Auftrag des Gemeindeauschusses schrieb daher der seinerzeitige Lehrer Albert Sturm (siehe auch Rubrik "Schule" / Vater des Angelus Sturm --> siehe Rubrik "Personen") am 02.04.1886 an den königlichen Bezirksamtmann Ender in Neumarkt:
"…Bezüglich der freiwilligen Feuerwehr erlaube ich mir, den königlichen Herrn Bezirksamtmann gehorsam zu bitten, ins Mittel zu treten. Weil ganz wenig mehr zusammen geht.
Der Kommandant wäre wohl sehr rührig, aber in einem großen Teil der Mannschaft fehlt der rechte Geist. Eine Drohung mit Pflichtfeuerwehr würde Rührigkeit erzielen und der Freiwilligen Feuerwehr mehr Mitglieder zuführen.
Die bisherigen Mitglieder ärgern sich, weil ein großer Teil der fähigen jungen kräftigen Leute sich zu gar nichts brauchen lassen will. Daß die Pavelsbacher immer erst etwas tun, wenn sie müssen, dürfte der historischen Begründung kaum entbehren...”
In der Folgezeit wurde dann tatsächlich die Feuerwehrpflicht eingeführt, die alle Männer der Altersklassen 18 bis 55 Jahre betraf. [22] Aber auch die Ausrüstung wurde 1890 durch die Anschaffung einer ersten Handdruckspritze deutlich verbessert. Dadurch konnten wesentlich bessere Löscherfolge erzielt werden als mit den bis dahin üblichen Eimerketten.
Auch ein erstes Feuerwehrgerätehaus mit Überdachung der Feuerwehrleiter und der Brandspieße wurde in diesem Jahr (entlang der heutigen Ludwigstraße zwischen Hs.Nrn. 60 und 57) errichtet. [85]
Weitere Informationen unter http://www.feuerwehr-pavelsbach.de/Festschrift.pdf
Große Kirchenrenovierung [1] 17] (von Wolfgang Fries)
Auf Betreiben des seinerzeitigen Expositus Gottfried Phillips wurde in 1890 mit einer grundlegenden Renovierung Dorfkirche (sowohl innen wie auch außen) begonnen. U.a. wurde die Kirche St. Leonhard vom Kunstmaler Sebastian Wirsching aus Diefurt/Altmühl mit 23 Fresken neu bemalt.
Ab 1897 folgte dann, auf Veranlassung des Expositus Michael Oeder, die Außenrenovierung der Kirche. [1] Die erheblichen Renovierungskosten in Höhe von insgesamt 11.000 Mark wurden von der Gemeinde Pavelsbach getragen. [17/Seite 173]
Einheitliche Zeitzone ab 1892 [46] [65] [127] (von Wolfgang Fries)
Nachdem auch Bayern von immer mehr Bahnstrecken durchzogen wurde und damit auch immer größere Entfernungen zurückgelegt wurden, war es notwendig, von der bis dahin geltenden Ortszeit (abhängig von jeweiligen Sonnenhöchststand am betreffenden Ort) auf eine einheitliche Zeit umzustellen.
Die Königreiche Bayern und Württemberg und das Herzogtum Baden vereinbarten daher in 1892 eine einheitliche Zeitzone entlang des 15. Längengrades, dem Vorläufer der MEZ. Mit dem Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung vom 12.03.1893 wurde diese Zeitzone für das gesamte Deutsche Reich bindend. [46] [127]
Vermutlich dürfte diese Neuerung aber an Pavelsbach zunächst vorbei gegangen sein, da zu dieser Zeit sehr wahrscheinlich keine Pavelsbacher täglich nach Außerhalb pendelten, obwohl in Nürnberg spätestens ab 1885 (mit den expandierenden Schuckert-Werken / Hercules-Werken / Victoria- Werken) die Industrielle Revolution mit voller Macht einsetzte.
Neumarkt bot zu dieser Zeit vermutlich noch zu wenig Industrie-Arbeitsplätze, da das in 1882 gegründete Neumarkter Express-Fahrradwerk in 1888 vollständig abbrannte und die Fertigung erst in 1889 wieder anlief. [65]
Wahl 1894 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Bürgermeister Hirschberger J. Willibald (Schmiebauá Nr. 66) werden gewählt.
Großer Kiefernspanner-Befall 1896 bis 1899 [8] (von Wolfgang Fries)
In den Jahren 1896 bis 1899 hat der Kiefernspanner große Teile der Wälder im Pyrbaumer und Allersberger Forst vernichtet. Auch der Wald rund um Pavelsbach war vom Schädlingsbefall stark betroffen. Die immensen Holzmengen konnten nicht abgefahren werden, da die schweren Holzfuhrwerke die Straßen Richtung Roth und zum Bahnhof Postbauer so beschädigt hatten, dass kein Durchkommen mehr war. Die Bayerische Staatspost war deswegen sogar gezwungen, die Briefzustellung im Zustellbezirk Pyrbaum (zu dem auch Pavelsbach gehöhrte) einzustellen, da kein Durchkommen mehr war.
Um diesen Mißständen nachhaltig entgegenzuwirken, wurde in 1899 die bereits seit 1893 in der Diskussion befindliche Lokalbahn, von Burgthann über Pyrbaum und Seligenporten nach Allersberg, in Angriff genommen. [8/Seiten 72 + 73]
Eine neue Orgel für Pavelsbach [1] [17] (von Wolfgang Fries)
In 1899 erhielt die Kirche St. Leonhard eine neue moderne Orgel. Die von der Firma Edenhofer aus Deggendorf gebaute Kirchenorgel ist noch heute in St. Leonhard zu hören. Die Anschaffungskosten von 2.400 Mark wurden mittels Spenden und aus freiem Vermögen der Kirchenstiftung finanziert. [1] [17/Seite 173]
1902: Die Feuerwehr wird besser ausgerüstet. [22]
(von Wolfgang Fries)
Unter Beteiligung des Bezirksamts Neumarkt wurde 1902 eine leistungsstarke Löschmaschine der Firma Braun (Nürnberg) angeschafft.
Anlässlich der Einweihung dieses hochmodernen Geräts versammelten sich die Mitglieder der Feuerwehr Pavelsbach zu einem Gruppenfoto.
In der ersten Reihe (5. Person von links) ist der damalige Kommandanten Stadelbauer Michael (Hs. Nr. 23) zu sehen. Beachtenswert sind die drei Bläser, die für die Alarmierung der aktiven Feuerwehrler zuständig waren. Hierbei liefen sie durch den Ort und bliesen das uns allen als "Martinshorn" bekannte Signal.
Bei diesen Trompetern dürfte es sich, von links nach rechts, um einen Kleesattl (Hs. Nr. 32), um Fries Georg (Hs. Nr. 5) und seinen Bruder Fries Johann (Hs. Nr. 4) handeln. Der ebenfalls abgebildete Trommler, vermutlich Sichert Martin (Hs. Nr. 76), sorgte dann dafür, dass die Truppe geordnet (vermutlich im Gleischritt) zum Brandherd vorrücken konnte.
Ab 1902 fährt der Allerberger Bockl [39] [8] (von Wolfgang Fries)
Die Generaldirektion der Bayerischen Staatsbahn teilte am 07. Mai 1899 mit, dass Lokalbahn Burgthann-Allersberg umgesetzt wird.
Nach der gesetzlichen Genehmigung vom 30.06.1900 begannen die Strecken-Bauarbeiten am 25. März 1901. Nach Fertigstellung und der feierlichen Eröffnung der Strecke Burgthann-Allersberg am 14. Dezember 1902 ging die Bahnstrecke am darauffolgenden Tag in Betrieb.
Der Bockl wurde in den Folgejahren - ab Bahnhof Seligenporten - von vielen Pavelsbachern zum Pendeln nach Nürnberg genutzt.
Die älteren Pavelsbacher erinnerten sich gerne an das weithin hörbare Pfeiffen der dort zum Einsatz kommenden Dampflokomotiven der Baureihe 86.
Bereits 1960 wurde auf der Strecke der Güterverkehr eingestellt. Am 03. Juni 1973 wurde die Bahnlinie vollständig aufgegeben.
Ein neuer Kreuzweg für St. Leonhard [17] (von Wolfgang Fries)
Aus Spendenmitteln wurde in 1902 für die Dorfkirche St. Leonhard ein neuer vierzehnteiliger Kreuzweg angeschafft. Das Gesamtwerk, dass noch heute in unserer Kirche zu sehen ist, wurde von der Anstalt für kirchliche Kunst in München der beiden Kirchenmaler Anton Ranzinger und Kaspar Lessing geschaffen. [17/Seite 173]
Gründung des Arbeitervereins Pavelsbach [21] (von Wolfgang Fries)
Im Novemver 1903 erfolgte die Gründung des Vereins auf Anregung eines zur Kirchweih in Pavelsbach weilenden Nürnbergers. Näheres hierzu ist der Rubrik "Vereine" zu entnehmen.
Fahnenweihe des Arbeitervereins Pavelsbach [21] (von Wolfgang Fries)
Am 20.08.1905 wurde die Vereinsfahne vom damaligen Expositus und Vereinspräses Sebastian Baumgartner geweiht.
Die Feierlichkeiten wurden im Garten beim Nähwiád (Hs.Nr. 67) abgehalten. Näheres hierzu kann unter der Rubrik "Vereine" nachgelesen werden.
Neubau des "Kleinen Schulhauses" 1905/1906 [34] (von Wolfgang Fries)
Wegen der steigenden Zahl schulpflichtiger Kinder entschloss sich der Gemeindeausschuss Pavelsbachs, unter Führung des Gemeindevorstehers Hirschberger (Hs. Nr. 89 Schmiebauà), zur Errichtung eines weiteren Schulgebäudes direkt neben dem "Großen Schulhaus". Im neuen Gebäude wurde in einem Nebenzimmer auch die "Gemeinde-Kanzlei" (mit Standesamt und Archiv) der politischen Gemeinde Pavelsbach untergebracht. (Weitere Details inkl. Bauplan siehe "Schule").
Gründung des Schützenvereins [23] (von Wolfgang Fries)
Beim Kesslwiád (Hs. Nr. 51) wurde am 28.02.1906 der "Zimmerstutzenverein Eichenlaub Pavelsbach" aus der Taufe gehoben. Näheres hierzu siehe Rubrik "Vereine".
Wahl 1912 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeindeausschuss sowie der neue Bürgermeister Klinger Johann (Frielbauá Hs. Nr. 22) werden gewählt.
Ausbruch des ersten Weltkriegs [49] [59] (von Wolfgang Fries)
Im August 1914 erklärte das Deutsche Reich den Großmächten Russland, Frankreich und England den Krieg. Aus Pavelsbach mussten 43 Männer in die Schützengräben Frankreichs, Polens und Russlands einrücken. Weitere Infos hierzu siehe Rubrik "HTV".
Nebenstehender Gedenkteller aus dem Jahre 1916 wurde von der Landesführung zur Stärkung der heimatlichen Moral und zur Aufbesserung der Kriegskasse verkauft.
Dank an Familie Karl (Hs.Nr. 72), die dieses Sammlerstück als Erinnerung bewahrt hat.
Gründung des Kriegervereins Pavelsbach 1919 [59] (von Wolfgang Fries)
Im Vereinslokal Muschaweckh (Kesslwiád Hs. Nr. 51) fanden sich die überlebenden Kriegsteilnehmer in 1919 zusammen und gründeten den Kriegerverein Pavelsbach, der das Andenken der 22 gefallenen und vermissten Pavelsbacher ehren sollte. Weitere Infos hierzu siehe Rubrik "HTV".
Die wilden 20er in Pavelsbach [22] [24] (von Wolfgang Fries)
Nicht nur in Berlin, nein auch in Pavelsbach waren die 20er des letzten Jahrhunderts wild. Wie verschiedene Quellen belegen, war nach dem Ende des 1. Weltkriegs der Lebenshunger auch der Pavelsbacher groß. Die jungen Leute, aber auch die Älteren, hatten nach mit Arbeit angefüllten Tagen am Sonntag keine Zeit für so banale Dinge wie z.B. Feuerwehrübungen. Vielmehr wurde die rare Freizeit auf Festen in der näheren und ferneren Umgebung verbracht (wie der damalige FF Hauptmann Karl Regnat in einem Schreibem vom 04.07.1928 dem Bezirksamt Neumarkt berichtet).
Hinzu kam die technische Modernisierung, die im gesamten Deutschen Reich vorangetrieben wurde. Auch in Pavelsbach wurden in den 1920ern, Großprojekte wie der Bau des Vereinshauses und einer ersten Wasserleitung sowie auch die Elektrifizierung des Dorfes umgesetzt, obwohl die Zeit nach dem 1. Weltkrieg bekanntermaßen von Hyperinflation und sehr großer Armut geprägt war.
Da die notwendigen Investitionen die Eigentümer der betroffenen Anwesen finanziell extrem belastete, wurde über die Sinnhaftigkeit jedes dieser Vorhaben bzw. deren Durchführbarkeit in Pavelsbach heiß diskutiert.
Insbesondere der Bau der ersten Wasserleitung sorgte in Pavelsbach für eine tiefe Spaltung der Dorfgemeinschaft in Befürworter (meist Anwesen ohne ergiebigen eigenen Brunnen) und Gegner (meist, aber nicht ausschließlich Anwesen mit ergiebiger Wasserstelle). Die sehr verhärteten Fronten verliefen hier quer durch den Ort und spaltete auch den damaligen Gemeindeausschuss.
Ins Bild passt hier aber auch die Causa Expositus Heinloth, die insbesondere in 1924 die Dorfgemeinschaft Pavelsbach zusätzlich aufwühlte (siehe Rubrik Pfarrgemeinde).
Fahnenweihe des Kriegervereins 1922 [59] (von Wolfgang Fries)
Im Sommer des Jahres 1922 wurde die Vereinsfahne vom damaligen Expositus Willibald Heinloth geweiht.
Die Festlichkeiten fanden anschließend im Garten des Gasthauses Schrödl (Hs. Nr. 10) statt.
Auch eine Gedenktafel für die gefallenen und vermissten Kameraden wurde in diesem Jahr an der südlichen Außenwand der St. Leonhard Kirche (links neben dem Eingang) angebracht. Weitere Details siehe Rubrik "HTV".
Wahl 1924 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeinderat sowie der neue Bürgermeister Siegert Konrad (Kesdlá Hs. Nr. 63) werden gewählt.
Gründung des Radfahrervereins Concordia 1924 [11]
(von Wolfgang Fries)
Bereits 1924 wurde auch in Pavelsbach ein Fahrradverein gegründet, der in der Folgezeit zu "Ausfahrten" einlud. Die Pavelsbacher zogen mit ihrer "Concordia" mit den Hengern gleich, die in 1906 den "Radsportverein Heng" gegründet hatten.
Erste Bebauung "An der Heide" in 1924 [15] (von Wolfgang Fries)
Das erste Gebäude an der pavelsbacher Hoi - eine Holzhalle - wurde in 1924 vom Maurermeister Georg Gärtner errichtet. An der Westseite der Straße baute er Sandkies ab und stellte (in der Holzhalle) daraus Betonsteine her. Um 1933 verkaufte Georg Gärtner sein Unternehmen an Heinrich Käser. Dieser errichtete eine Betonhalle und produzierte bis 1959 Betonsteine an der pavelsbacher Hoi. [15/Seite 225]
Brandunglücke in den Jahren 1924 und 1925 [15] (von Wolfgang Fries)
Die Brandserie dieser Jahre begann am 12.09.1924, als die Gastwirtschaft zur Linde (Hs. Nr. 10 Schráil) vollständig abbrannte.
Am 08.04.1925 brannten dann das Wohnstallgebäude sowie die Scheune des Anwesens Hs. Nr 78 (Uwáda+ffá Glousn) nieder. In der Nacht vom 24. auf den 25.11.1925 wurden dann die Scheunen der Anwesen Hs. Nr. 50 (Schwengng) und Hs. Nr. 51 (Kesslwiád) ein Raub der Flammen.
Infolge dieser vielen Brandunglücke hat dann die Gemeinde Pavelsbach beschlossen, umgehend eine Wasserleitung zu bauen. [15/Seite 198]
Wahl 1927 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeinderat sowie der neue Bürgermeister Hirschberger Willibald (Schmiebauà Hs. Nr. 89) werden gewählt.
Die Elektrifizierung Pavelsbachs in 1927 [15] (von Wolfgang Fries)
Bereits am 23.12.1918 fasste der Gemeindeausschuss unter der Führung des damaligen Bürgermeister Johann Klinger (Frielbauá Hs. Nr. 22) den Beschluss "Es sei baldigst ein Vertrag mit den Fränkischen Überlandwerken zwecks Versorgung der Gemeinde Pavelsbach mit elektrischem Licht & elektrischer Kraft abzuschließen".
Da jedoch ein größerer Teil der (strom-)anschlusswilligen Grundstückseigentümer gegen die zu dieser Zeit im Bau befindliche Wasserleitung opponierte, distanzierte sich der Gemeinderat in der unmittelbaren Folgezeit zunächst von diesem Beschluss.
Noch am 25.04.1926 beschließt der seinerzeit amtierende Gemeinderat unter Leitung des Bürgermeisters Konrad Siegert Kestlá Hs.Nr.63): "1. Der Ausbau des Ortsnetzes wird nicht genehmigt, alle auf oder über gemeindlichen Grundstücken zuliegenden Anlagen sind keinesfalls vor Genehmigung zu beginnen. 2. Die derzeit laufenden Arbeiten sind somit einzustellen."
Den betreffenden Gemeinde-Sitzungsprotokollen ist zu entnehmen, dass für den Gemeinderat die Errichtung der Wasserleitung vorrang hatte und zunächst dieses Projekt zum Abschluss gebracht werden sollte.
Diese Haltung änderte sich jedoch spätestens nach den 1927er Wahlen zum Gemeindausschuss und des neuen Bürgermeisters.
Noch im selben Jahr kam es zum ersten Stromanschluss in Pavelsbach. Eine Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung hatten hierbei wohl ván Fiechálá (Hs.Nr. 60, Ludwigstr. 13). Auch heute noch steht das Transformatorhäuschen an der Grundstücksgrenze der Anwesen Ludwigstraße 13 /15.
Bereits am 22.01.1927 stellte die Firma "Fränkische Licht und Kraftversorgung Aktiengesellschaft Bamberg" eine Rechnung an den Eigentümer des Hauses Nr. 60 in Höhe von insgesamt 293,72 Mark für 6 (!!) Brennstellen (2 x 25 Watt und 4 x 15 Watt) und eine Kraftleitung für einen 3 PS Elektromotor.
Nach und nach wurden noch in 1927 weitere pavelsbacher Anwesen an das Stromnetz angeschlossen. Insbesondere der umtriebige Expositus Otto Brenner tat sich als großer Befürworter der neuen Technik hervor und soll auch eigenhändig notwendige Installationsarbeiten in der Kirche und im Pfarrhaus vorgenommen haben.
Der "St. Willibalds-Bote" aus Eichstätt (Kirchenzeitung) schreibt in einem Bericht vom 12.02.1938 hierzu: "1927 kam das elektrische Licht ins Dorf. Es schlossen sich 19 an, später immer mehr. Am Weihnachtsfeste 1927 wurde beim Gloria der Christmette zum ersten mal das elektrische Licht in der Kirche eingeschaltet."
Weitere interessante Details hierzu siehe auch Unterlage [15/Seiten 102 ff.].
Fertigstellung der ersten pavelsbacher Wasserleitung in 1928 [22]
(von Wolfgang Fries)
Bereits in 1926 wurden mit den umfangreichen Baumaßnahmen begonnen. Hierzu wurde ein Teil der Sulz (noch auf dem Gebiet der Gemeinde Tyrolsberg - vermutlich auf Höhe des Lachenbühls) in eine Rohrleitung abgeleitet und bis zum "Wasserreserv" auf dem pavelsbacher "Schdrousbuug" (Anhöhe über dem Ort in Richtung Berngau) geführt. Von dort aus erfolgte dann der Anschluss der Pavelsbacher Anwesen. Diese Arbeiten konnten in 1928 zum Abschluss gebracht werden.
Wie es in Pavelsbach gute Tradition ist, wurde dies mit einem denkwürdigen "Wasserfest" gefeiert. Oben das betreffende Erinnerungsfoto mit den Honoratioren des Dorfes.
Bei der neunten Person (stehend) von links dürfte es sich um den Feuerwehr-Kommandanten Karl Regnat (Häináscháusda Hs.Nr. 49) handeln. Rechts daneben (im hellen Anzug) steht der Dorflehrer Anton Stoiber. Bei der fünften sitzenden Person (von links) dürfte es sich um Bürgermeister Willibald Hirschberger handeln. Links neben ihm sitzt sein Amtsvorgänger Konrad Siegert.
Weitere Daten hierzu werden derzeit erhoben.
Großfeuer im Juli 1928 [22] [24] (von Wolfgang Fries)
Am 04.07.1928 brannten die Scheunen der Anwesen Hs. Nrn. 72 (Schmie), 73 (Buáchá) und 74 (Boüsdá) sowie die Wohnhäuser der beiden Anwesen Hs. Nrn. 73 (Buáchá) und 74 (Boüsdá) ab.
Ein Übergreifen auf das Anwesen Hs.Nr. 75 (Schdiglbauán) konnte nur durch den beherzten Einsatz des Schdiglbauán selbst (Ludwig Kneißl) und dessen Knecht Franz Beyerle sowie des Ba+láfeál Lugg (Ludwig Harrer) und des Dessawá Wasdl (Sebastian Fries) verhindert werden.
Vermutlich wäre der Brand völlig außer Kontrolle geraten, wenn die in diesem Jahr errichtete erste Wasserleitung nicht bereits einsatzbereit gewesen wäre.
Im Nachgang zu diesem Großbrand gab es polizeiliche Ermittlungen, da die Löschversuche der Freiwilligen Feuerwehr Pavelsbach von nur sehr mäßigem Erfolg waren. Dies wurde in erster Linie auf die tiefe Spaltung der Pavelsbacher in Wasserleitungsbefürworter und -gegner zurückgeführt, welche sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr auswirkte. Letztlich hat das Eingreifen von "Privatpersonen" und Nachbarwehren weitere Schäden abgewendet.
Die polizeilichen Ermittlungen offenbarten ein systemisches Versagen, dass auf persönliche Animositäten der maßgeblichen Personen zurückzuführen war. Einzelnen Personen konnte vom Bezirksamt Neumarkt jedoch kein Verschulden nachgewiesen werden.
Für die vom Großbrand Geschädigten verblieb dennoch ein recht bitterer Beigeschmack.
Fahnenweihe des Radfahrvereins Concordia [15] (von Wolfgang Fries)
Ebenfalls in 1928 wurde die Standarte des Fahrradvereins geweiht. Die auf Kosten des TSV Pavelsbach renovierte Standardt wird mittlerweile vom Sportverein als Vereinsfahne genutzt.
Errichtung des Vereinshauses [21] (von Wolfgang Fries)
Auf Initiative des damaligen Expositus Otto Brenner, der gleichzeitig das Amt des Präses des Arbeitervereins (siehe Rubrik Vereine) ausübte, wird 1928 in Pavelsbach das Vereinshaus durch den Arbeiterverein errichtet. Der Ort verfügte damit über einen veritablen Versammlungsort bzw. über einen Theatersaal, der zu jener Zeit seinesgleichen suchte. Siehe auch Rubrik "Vereine".
Einrichtung einer Kleinkinderschule in 1928 [35] (von Wolfgang Fries)
Der weitsichtige und im Dorf äußerst beliebte Expositus Otto Brenner initiierte bereits in 1928 eine Kinderschule für Kleinkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren (dem Vorläufer des heutigen Kindergartens), die bis 1938 Bestand hatte.
Unterstützt wurden er und sein Nachfolger Josef Scheiber hierbei von den beiden "Niederbronner Schwestern" Ambrosia und Bernadett, die von der Seligenportner Schwesternstation mit dem Fahrrad zur Kinderbetreuung nach Pavelsbach kamen und die Kinder in und am neu errichteten Vereinshaus beaufsichtigten.
Fahrrad-Bezirksmeisterschaft von 1929 (von Wolfgang Fries)
In 1929 errang Michael Metzger (Hs.Nr. 14) für den Pavelsbacher Fahrradverein "Concordia Pavelsbach" die Bezirksmeisterschaft.
Amtsverzicht 1932 [15] (von Wolfgang Fries)
Der in 1927 gewählte Bürgermeister Hirschberger Willibald (Schmiebauá Hs.Nr. 89) trat am 13.09.1932 von seinem Amt zurück.
Grund hierfür waren erhebliche Streitigkeiten mit seinem Amtsvorgänger Siegert Konrad (Kesdlá Hs. Nr. 63).
Die Amtsgeschäfte übernahm der stellvertretende Bürgermeister Klinger Johann sen. (Frielbauá Hs. Nr. 22).
Wahl 1933 und NS-Machtergreifung [15] (von Wolfgang Fries)
Auch in Pavelsbach wurde ein NSDAP-Stützpunkt gegründet, der an die Ortsgruppe Postbauer angegliedert war. Der 1. Stützpunktleiter war Siegert Konrad (Kestlá Hs. Nr. 63), der das politische Leben in Pavelsbach leitete.
Zwar durften der in 1933 neu gewählte Gemeinderat und Bürgermeister Klinger Johann sen. (Frielbauá Hs. Nr. 22) die Geschicke der Gemeinde Pavelsbach zunächst weiter lenken, jedoch drängte die NSDAP immer stärker in die Gemeindeverwaltung.
Um die daraus resultierenden erheblichen dörflichen Konflikte (die insbesonders wegen den Spannungen zwischen dem NSDAP-Ortsvorsitzenden Siegert und dem gewählten Bürgermeister Klinger entstanden) etwas zu entschärfen, ernannte in 1935 die Kreisleitung der NSDAP in 1935 Dotzer Franz (Hs. Nr. 48) zum Bürgermeister.
Nach und nach kam - auf Drängen der NSDAP - in der Folgezeit in Pavelsbach das Vereinsleben zum Erliegen und die kirchliche Kleinkinderschule wurde zwangsweise aufgehoben. Der Radfahrverein, der Arbeiterverein und der Schützenverein wurden de facto aufgelöst und der Kriegerverein in den Kyffhäuserbund überführt.
Hinweis zur Verwendbarkeit der obigen Abbildung des NSDAP-Parteiabzeichens:
Dieses Bild zeigt ein (oder ähnelt einem) Symbol, das von nationalsozialistischen oder anderen in der Bundesrepublik Deutschland wegen Verfassungswidrigkeit verbotenen Organisationen verwendet wurde. Die Verwendung dieser Symbole in der Öffentlichkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland verboten (§ 86a StGB). Ebenfalls strafbar ist die Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB). Die Strafbarkeit ist ausgeschlossen, wenn die Verwendung oder Verbreitung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient (§ 86 Abs. 3 StGB).
Die Jagdgenossenschaft Pavelsbach entsteht [54] (von Wolfgang Fries)
Mit dem Reichsjagdgesetz vom 3. Juli 1934 wurde auch in Pavelsbach kraft Gesetzes (gem. § 9 BJagdG, d.h. ohne dass es eines Beschlusses der Gemeinde oder irgend eines anderen rechtlichen Aktes bedurfte) die Jagdgenossenschaft in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet.
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (die Jagdgenossen) sind nach wie vor die Eigentümer der Flächen, die zum Jagdbezirk Pavelsbach gehören. Zum Jagdbezirk gehören alle Grundflächen der (ehemaligen) Gemeinde Pavelsbach.
Gründung des Kirchenchores (von Wolfgang Fries)
Auf Initiative des damaligen Expositus Josef Scheiber wurde in 1935 der Kirchenchor gegründet. Näheres hierzu ist der Rubrik "Vereine" zu entnehmen.
Pavelsbach und die Deutsche Gemeindordnung vom 30.01.1935
(von Wolfgang Fries)
Zwar blieb die kommunale Selbstverwaltung nominell (de jure) erhalten, faktisch jedoch wurde sie mit Einführung der Deutschen Gemeindeordnung abgeschafft. Auch in Pavelsbach gab es daher weder einen gewählten Gemeinderat noch einen gewählten Bürgermeister. Fortan gab es zwar einen Bürgermeister in Pavelsbach, dieser wurde jedoch von der Kreisleitung der NSDAP beauftragt. Der Bürgermeister wiederrum berief, in Absprache mit der NSDAP, die Gemeinderäte.
Am 01.10.1935 wurde Dotzer Franz (Hs. Nr. 48) zum Bürgermeister berufen (siehe auch oben). Er führte die Amtsgeschäfte bis Juni 1942. Aufgrund eines Disputs mit dem örtlichen NSDAP-Leiter Zech Josef (Hs. Nr. 55) wurde er aus dem Amt entlassen und durch den Pöllinger NSDAP-Ortsgruppenleiter Beck ersetzt, der das Bürgermeisteramt in Pavelsbach bis Dezember 1943 ausübte. Ab Dezember 1943 bis zum Kriegsende 1945 übernahm dann NSDAP-Leiter Zech die Amtsgeschäfte als Bürgermeister.
Der Zweite Weltkrieg [50] [59] (von Wolfgang Fries)
Am 01. September 1939 begann der zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. 46 Pavelsbacher mussten in diesem Krieg ihr Leben lassen. Nähere Infos hierzu siehe Rubrik "HTV".
Fliegerangriff auf Pavelsbach am 21.04.1945 [15] [18] [108]
(von Wolfgang Fries)
Im kollektiven Gedächtnis der Pavelsbacher hat sich dieses Ereignis tief eingegraben. Nach Aussagen von Augenzeugen, gemäß dem Bericht des damaligen Expositus Bauernfeind an das bischöfliche Ordinariat Eichstätt, sowie dem Kriegstagebuch der Waffen-SS-Einheit "Götz von Berlichingen", lässt sich für Pavelsbach nachstehender Ablauf der Geschehnisse der letzten Kriegstage rekonstruieren:
Bereits Anfang April 1945 wurden die Pavelsbacher Bauern dazu (zwangs-)verpflichtet, Granaten und Munition vom damaligen Bahnhof Freystadt zu den von der SS geplanten Abwehrstellungen zu bringen. Ein "ganzer Berg" gefährlicher Abwehrwaffen blieb im Wald zwischen Pavelsbach und Röckersbühl bis nach Kriegsende ungenutzt zurück.
Direkt am Ortsausgang, an der heutigen Simonstraße, musste der Volkssturm (die alten Männer des Dorfes) eine Barriere errrichten. Hierzu mussten die 10 bis 15 Männer links und rechts der Straße tiefe Löcher ausheben und dort schwere Baumstämme versenken. Darüber wurden dann weitere Baumstämme quer gelegt. Diese Konstruktion sollte die amerikanischen Panzer an der Weiterfahrt hindern.
In der dritten Aprilwoche wurden die Truppenstärke der Waffen-SS in Pavelsbach merklich erhöht und Vorbereitungen zur Verteidigung des Ortes verstärkt. Im Laufe dieser Tage wurde den Pavelsbachern klar, dass die Soldaten die Zerstörung des Ortes durchaus in Kauf nahmen. Sogar auf dem Kirchturm von St. Leonhard wurde ein Beobachtungsposten eingerichtet. Der seinerzeitige Expositus versuchte die SS-Soldaten zum Abzug zu bewegen. Dies gelang ihm zwar nicht, räumten jedoch zumindest den Beobachtungsposten auf dem Kirchturm.
Am Samstag den 21. April begann die amerikanische Artillerie, wohl vom Dillberg aus, über Pavelsbach hinweg zu schießen. Diese Geschosse rissen wenige hundert Meter hinter dem Frielbauán-Anwesen (Hs.Nr. 22 / Ottostr. 3) tiefe Bombentrichter in die Felder. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein Großteil der zwischen 100 und 200 Mann starken SS-Truppe aus Pavelsbach abgesetzt.
Gegen 13:00 Uhr zogen dann tieffliegende Aufklärungsflugzeuge über Pavelsbach und machten eine Gruppe von SS-Soldaten aus, die u.a. mit Panzerfäusten bewaffnet, in der heutigen Simonstraße unterwegs waren.
Kurz darauf, zwischen 13:30 und 14:00 Uhr folgte dann zunächst ein Tieffliegerangriff durch 8 Jagdbomber. Die Bordkanonen dieser Maschinen dürften wohl auch den damals 17-jährigen Nikolaus Kleesattl (Hogl Niggl Hs. Nr. 32) auf Höhe des Anwesens Ludwigstraße 39 getroffen haben. Expositus Bauernfeind berichtet hierzu, dass Nikolaus Kleesattl zunächst noch lebte, ihm jedoch wegen des andauernden Angriffs zunächst niemand zur Hilfe kommen konnte. Der Expositus schreibt weiter: "Er konnte noch versehen werden (Krankensalbung) und starb dann nach einer Stunde schrecklicher Schmerzen". Eine Zeitzeugin hat diese Vorgänge recht drastisch beschrieben ("Ich sehe noch die Gänseherde mit den Gänschen, wie sie reiheweise zerfetzt durch die Luft flogen").
Danach begann die Bombardierung des Ortes durch Artillerie- und Fliegerbeschuss. Eine große Menge an Brand- und Sprengbomben ging hierbei auf Pavelsbach nieder.
Neben dem bereits genannten Nikolaus Kleesattl (+ 21.04.1945 Schussverletzung) musste Pavelsbach noch die zehnjährige Maria Fries (Hs.Nr. 57 Wongá + 24.04.1945 Granatsplitter-Verletzung) und die Lehrerin Franka Baier (+ 03.07.1945 im Krankenhaus Beilngries wegen eines abgetrennten Arms) betrauern.
Neben den Verlusten an Menschenleben wirkten auch die erheblichen Zerstörungen des Dorfes traumatisierend auf die Bewohner. Nachstehend eine kurze Aufstellung der Gemeinde Pavelsbach zu den Zerstörungen:
Hs-Nr. | Hausname | heutige Adresse | Wohnhaus | Scheune |
1 | Lehnà | Simonstr. 2 | 1 | |
2 | Maddásimmá | Simonstr. 9 | 1 | |
3 | Miádsn | Simonstr. 4 | 1 | 1 |
4 | Desawá | Simonstr. 6 | 1 | 1 |
5 | Undàda+fà Glousn | Simonstr. 5 | 1 | 1 |
6 | Wewàmichl | Simonstr. 11 | 1 | |
7 | Liál | Simonstr. 13 | 1 | 1 |
8 | Schlächá | Simonstr. 10 | 1 | |
9 | Ha+nsl | Simonstr. 12 | 1 | 1 |
11 | Heádnfähn | Simonstr. 16 | 1 | 1 |
12 | Häiná | Simonstr. 17 | 1 | 1 |
13 | Wäsnschmie | Simonstr. 15 | 1 | 1 |
14 | Geàlidsn | Heinrichstr. 19 | 1 | 1 |
15 | Schräiná | Heinrichstr. 17 | 1 | 1 |
17 | Scháüwewà | Heinrichstr. 12 | 1 | |
18 | Gráisá | Heinrichstr. 13 | 1 | 1 |
19 | Niggálá | Heinrichstr. 11 | 1 | |
22 | Frielbauàn | Ottostr. 3 | 1 | 1 |
24 | Schbidsn | Heinrichstr. 9 | 1 | 1 |
25 | Sädnà | Heinrichstr. 10 | 1 | |
27 | Bschiál | Heinrichstr. 6 | 1 | 1 |
28 | Leádsá | Heinrichstr. 7 | 1 | 1 |
30 | Aüwádn | Heinrichstr. 4 | 1 | |
33 | Hoindsáschädá | Ludwigstr. 32 | 1 | |
34 | Hofnáfriel | Ludwigstr. 30 | 1 | |
39 | Ba+ddl | Ludwigstr. 28 | 1 | |
51 | Kesslwiád | Ludwigstr. 16 | 1 | |
52 | Fläschmichl | Ludwigstr. 23 | 1 | |
53 | Niggl | Ludwigstr. 14 | 1 | |
54 | Hoárá | Ludwigstr. 21 | 1 | |
62 | Roumbauán | Ludwigstr. 4 | 1 | 1 |
67 | Näwiád | Paulstr. 7 | 1 | |
68 | Gra+dsl | Paulstr. 9 | 1 | |
73 | Buáchá | Paulstr. 10 | 1 | |
74 | Boüsdá | Paulstr. 8 | 1 | |
76 | Wasslbegng | Paulstr. 6 | 1 | |
18 | 34 |
Somit wurden in wenigen Stunden 52 Pavelsbacher Gebäude vernichtet (kleinere Stallungen und Nebengebäude nicht mitgezählt). Man mag sich kaum vorstellen, welcher Feuersturm über Pavelsbach hinwegzog und welche Schrecken dies bei Kindern, Erwachsenen und Greisen hinterließ.
Rund ein Viertel der Pavelsbacher - vor allem im Unterdorf - wurde obdachlos und verlor an diesem Tag darüber hinaus den gesamten Hausrat. Ein Teil des Viehbestands, viele Werkzeuge und Maschinen sowie die in den 34 abgebrannten Scheunen noch lagernden Futtermittel wurden ebenfalls ein Raub der Flammen.
Die Pavelsbacher mussten in der Folgezeit "zusammenrücken" und obdachlose Verwandte unterbringen. Sechs Personen und mehr schliefen auf Strohsäcken in einem Zimmer. In manchem Haus drängten sich vorübergehend bis zu 14 Menschen auf engstem Wohnraum.
Die mit Ende des Weltkriegs einsetzende Hyperinflation und die damit einhergehende Armut sowie der Mangel an Arbeiteskräften verhinderten einen zügigen Wiederaufbau. Baumaterialien wie Zement, Löschkalk oder Dachziegeln waren auf dem freien Markt nicht käuflich. Letztlich blieb den "abgebrannten" Pavelsbachern nichts anderes übrig, als die verbliebenen (wenigen) Lebensmittel bzw. landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf dem Schwarzmarkt gegen Baumaterialien zu tauschen.
Ein detaillierter Bericht über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Zerstörungen in der Marktgemeinde Postbauer-Heng ist der unter [15] genannten Unterlage zu entnehmen (in der Marktverwaltung käuflich zu erwerben). Dort kommen auch einige Zeitzeugen zu Wort.
[29] Nach Kriegsende nimmt sich zunächst der Ortsgeistliche Bauernfeind der Organisation des Wiederaufbaus Pavelsbachs an. Als erster erhält der Schmiedemeister Gruber (Wäsnschmie Hs.Nr. 13) Baumaterialien für den Wiederaufbau insbesondere der Schmiede, damit er in die Lage versetzt wurde, die für den Wiederaufbau des Dorfes dringend benötigten Werkzeuge zu fertigen. Darüber hinaus gab es von der Gemeinde eine "Haushaltsbeihilfe" von 100,00 Reichsmark für jedes "abgebrannte" Anwesen, da dort sämtlicher Hausrat vernichtet wurde.
Das Wahlrecht wird in 1945 auf Gemeindeebene wieder hergestellt [15] [107] (von Wolfgang Fries)
Mit der provisorischen Gemeindordnung vom 18.12.1945 wurde das demokaratische Wahlrecht für Gemeinderäte und den Bürgermeister wieder eingeführt. [107]
Am 27. Januar 1946 fanden dann die ersten Nachkriegs-Gemeindewahlen im Landkreis Neumarkt statt. Hierbei wurde Kerschensteiner Franz (Bandsá Hs. Nr. 45) zum Bürgermeister gewählt. [15]
Wahl vom 01.06.1948 [15] [122] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeinderat sowie der neue Bürgermeister Meier Michael (Fiechálá Hs. Nr. 60) werden gewählt. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Begleitung des Wiederaufbaus des Unterdorfs.
Kreistagswahl vom 30.03.1952 [122] (von Wolfgang Fries)
Erstmals zieht ein Pavelsbacher in das höchste Gremium auf Landkreisebene ein. Der CSU-Kandidat Muschaweck Josef (Kesslwiád Hs. Nr. 51) errang hierbei Platz 19 der CSU-Wahlliste.
Gründung der Blaskapelle Pavelsbach 1954 [62]
(von Wolfgang Fries)
Wegen der kriegsbedingten Verluste war es nach dem 2. Weltkrieg zunächst nicht möglich "Die Pavelsbacher", die bis dahin bestanden, wieder aufleben zu lassen. In 1954 fanden sich daher auf Einladung von Fries Josef (Brongá Sebb Hs. Nr. 88) mehrere Jugendliche zusammen und gründeten mit ihm die Blaskapelle. Näheres siehe Rubrik "Vereine".
Neugründung des Schützenvereins "Eichenlaub" Pavelsbach [23] (von Wolfgang Fries)
Nachdem der Schießsport von der Obrigkeit wieder erlaubt worden war, konnte der Schützenverein 1954 ein weiteres mal gegründet werden. Siehe auch Rubrik "Vereine".
Wahl 1956 [15] (von Wolfgang Fries)
Der Gemeinderat sowie der letzte Pavelsbacher Bürgermeister Hirschmann Johann (Keáná Hs. Nr. 71) werden (erstmals) gewählt.
Kreistagswahlen vom 18.03.1956 [122] (von Wolfgang Fries)
Muschaweckh Josef (Kesslwiád Hs. Nr. 51) konnte seinen Sitz im Kreistag verteidigen und zieht auch in die neu gewählte Volksvertretung ein. Leider verstarb dá Kesslwiád am 28.05.1961 viel zu früh im Alter von von 58 Jahren.
Fahnenweihe des Schützenvereins in 1956 [23] (von Wolfgang Fries)
Im Mai 1956 wurde die Vereinsfahne von Expositus Oskar Stejskal geweiht. Die unter der Schirmherrschaft des damaligen Landrats Dr. Otto Schedl stattgefundene Festivität sowie das Preisschießen waren ein großer Erfolg für den Verein. Näheres hierzu siehe Rubrik "Vereine".
Neugründung des Kriegervereins 1956 [59] (von Wolfgang Fries)
Am 10.06.1956 hat der damalige Bürgermeister Hirschmann Johann (Hs. Nr. 71) die Gründungsversammlung einberufen. 52 Kriegsteilnehmer folgten seinem Ruf und gründeten nochmals den in den Kriegswirren untergegangenen Kriegerverein Pavelsbach. Weiteres siehe Rubrik "HTV".
Fahnenweihe des Kriegervereins 1958 [59] (von Wolfgang Fries)
Die Fahnenweihe erfolgte am 20.07.1958 durch den seinerzeitigen Expositus Oskar Stejskal.
Am gleichen Tag wurde auch das Kriegerdenkmal bei der Dorfkirche eingeweiht. Weitere Details siehe Rubrik "HTV".
Feuerlöschweiher für Pavelsbach [22] [122] (von Wolfgang Fries)
In 1958 hat die Gemeinde Pavelsbach die Anlage der beiden Löschweiher am Ortsrand Richtung Berngau (rechts gelegen) und an der Südseite der Ecke Ludwig-Heinrichstraße abgeschlossen und hierüber den Brandschutz in Pavelsbach merklich verbessert. Der Landkreis Neumarkt unterstützte die Baumaßnahmen, die von den Pavelsbachern größtenteils in Handarbeit durchgeführt wurde, mit einem Zuschuß in Höhe von DM 10.000,00.
Gründung des Wasser- und Bodenverbandes Pavelsbach 1958 [63]
(von Wolfgang Fries)
Bereits seit 1955 wurde im Gemeinderat Pavelsbach über die unzureichende Anbindung des Ortes an den überörtlichen Verkehr diskutiert. Zu dieser Zeit gab es in Pavelsbach noch keine befestigte Orts- oder gar Kreisstraße und auch keinerlei Brückenbauwerke. Dies bedeutete, dass die (unbefestigte) Ortsverbindungsstraße Richtung Seligenporten (zur Bahnstrecke "Allersberger Bockel") des Öfteren nicht genutzt werden konnte, da der Pegel des Hengerbachs für die Durchquerung der dortigen Furt zu hoch war. An manchen Tagen war dann auch noch die Furt "An der Heide" soweit unter Wasser, dass auch diese (unbefestigte) Verbindungsstraße unpassierbar wurde.
Vorhandene Fotos von Ortsverbindungsstraßen der 1950er und 1960er:
Heutige Einmündung Sebastian-/Paulstraße | Ortsverbindungsstraße Richtung Möning |
Hinzu kam der äußerst schlechte Unterhaltungszustand Pavelsbacher Fließgewässer. Der Lacherlgraben (von der Au zum Lohgraben), der Lohgraben (südl. von Pavelsbach) und auch der Hengerbach (nördlich von Pavelsbach) waren großteils verlandet und verwachsen und verliefen im Gelände meist oberhalb der umliegenden Wiesen und Felder. Bei geringsten Hochwässern wurden daher große Bereiche der pavelsbacher Flur überflutet. Die Versumpfung vieler landwirtschaftlicher Grundstücke war die Folge hiervon.
Auf die Initiative des Bürgermeisters Hirschmann hin, wurde Anfang des Jahres 1958 (über das Satzungsrecht der Gemeinde Pavelsbach) der "Wasser- und Bodenverband Pavelsbach" geschaffen. Verbandsmitglieder waren alle landwirtschaftlichen Betriebe Pavelsbachs. Zu jener Zeit betraf das nahezu sämtliche Anwesen des Ortes.
In der ersten Verbandsversammlung wurde Lehner Johann (Hs.Nr. 1) zum Verbandsvorsitzenden und Wild Johann (Hs.Nr. 43) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Unter Einbindung der Gemeindeverwaltung Pavelsbach, des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg, der Moorwirtschaftsstelle Weiden, des Bayerischen Bauernverbands, des Landwirtschaftsamtes Neumarkt und des Landratsamtes Neumarkt (als Aufsichtsbehörde) wurde im Herbst 1958 mit der Errichtung von 8 Brückenbauwerken, der Sanierung der Bachläufe auf einer Gesamtlänge von 10 km sowie mit der Entwässerung von 80 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche begonnen.
Der Pavelsbacher Wasser- und Bodenverband erwarb hierzu einen Grabenbagger, der sowohl für den Böschungsausbau als auch für das Verlegen von Drainagen geeignet war.
Am 3. Januar 1959 berichtete das Neumarkter Tagblatt über die Arbeiten am ersten Bauabschnitt. Insbesondere die Grabenbauarbeiten ganz zu Beginn der Maßnahme, am Kesselweiher, gestalteten sich demnach sehr schwierig, da dort der Grabenbagger aufgrund der äußerst widrigen Bodenverhältnisse nicht eingesetzt werden konnte.
Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurde noch im Spätherbst und Winter 1958 in Tag- und Nachtschichten (der Verbandsmitglieder!!!) - auf einer Länge von 1.200 Metern - ein 10 Meter breiter und 1,60 Meter tiefer Graben ausgehoben.
Auch die Fundamentarbeiten für 2 Brücken wurden von der ausführenden Firma Tagmann noch in 1958 abgeschlossen. [63]
Baubeginn der zweiten Pavelsbacher Wasserleitung 1959 [15]
(von Wolfgang Fries)
Am 04.10.1958 gründeten die damaligen Gemeinden Möning, Seligenporten, Rengersricht und Pavelsbach den Zweckverband zur Versorgung der Möninger Gruppe.
Bereits in 1959 wurde mit dem Bau begonnen. Die Errichtung der Tiefbrunnen westlich von Möning, eines Hochbehälters auf dem Möninger Berg sowie des Versorgungsnetzes wurde dann 1963 abgeschlossen.
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr 1959 [22] (von Wolfgang Fries)
Am 31.05.1959, zum 75. Gründungsjubiläum der Wehr, empfing die Fahne dem kirchlichen Segen vom damaligen Expositus Stejskal. Weitere Informationen dazu unter http://www.feuerwehr-pavelsbach.de/Festschrift.pdf
Einweihung des Feuerwehrhauses mit Schlauchturm [22]
(von Wolfgang Fries)
In Gemeinschaftsarbeit errichteten die Pavelsbacher Anfang 1961 in der Ludwigstraße 7 ein topmodernes Feuerwehrhaus mit Schlauchturm. Planung, Grundstück und Material wurden von der Gemeinde Pavelsbach gestellt.
Begleitet vom kirchlichen Dienst und dem Kirchechor spendete der seinerzeitige Expositus dem Gebäude am 11.06.1961 den kirchlichen Segen. Neben den Abordnungen der Ortsvereine, dem Bürgermeister Johann Hirschmann und den Gemeinderäten nahmen auch der damalige Landrat Josef Werner Bauer sowie der seinerzeitige Kreisbrandinspektor Ochsenkühn an diesem Festakt teil. Musikalisch umrahmt wurde diese Feierstunde von der Blaskapelle Pavelsbach.
Die Pavelsbacher Feuerwehr wird 1962 Stützpunktfeuerwehr [22]
(von Wolfgang Fries)
Aufgrund der vorbildlichen Ausrüstung der Wehr durch die Gemeinde Pavelsbach, aber auch wegen des hervorragenden Leistungsstands der Pavelsbacher Wehr überbrachte Kreisbrandinspektor Ochsenkühn in 1962 den Auftrag des Kreistags zur Stützpunktfeuerwehrberufung. Mit diesem Auftrag wurde der Pavelsbacher Wehr (als einer von zwei Wehren im Altlandkreis Neumarkt) ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF8 - Opel Blitz) zugeteilt.
Fertigstellung der Brücken- und Wasserbauwerke in Pavelsbach [63] (von Wolfgang Fries)
Am Sonntag dem 10. Februar 1963 feierten die Pavelsbacher den Abschluss der sehr umfangreichen und tlw. extrem schwierigen Arbeiten.
Im Einzelnen waren dies:
- Sanierung der Pavelsbacher Fließgewässer auf einer Gesamtlänge von rd. 10 Kilometern.
- Errichtung von 8 Brückenbauten (davon 4 Brücken mit einer Tragkraft von 30 Tonnen).
- Entwässerung von 80 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Verlegung von Drainagen auf einer Gesamtlänge von 70 Kilometern.
Der Landkreis Neumarkt hat hierbei den Großteil der Kosten übernommen. Insgesamt erhielt die Gemeinde Pavelsbach einen Herstellungszuschuss in Höhe von DM 650.000,00. [122]
Gründung des TSV Pavelsbach 1965 [104] (von Wolfgang Fries)
Insbesondere auf Initiative des Johann Nunner (1936-2000, Schöpfö Báidá Hs. Nr. 64), der im Verein später auch die verschiedensten Funktionen ausübte, wurde am 05.03.1965 der Verein gegründet. Weiteres kann unter https://tsv-pavelsbach.de/verein/chronik/ nachgelesen werden. [104]
Flurbereinigung, Kanal- und Ortsstraßenbau in Pavelsbach [63] [64]
(von Wolfgang Fries)
Um den durch die Realteilung zersplitterten Grundbesitz neu zu ordnen und dadurch die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern, wurde in 1968 in Pavelsbach mit der Flurbereinigung begonnen. [64]
Zunächst musste sich hierzu die Pavelsbacher Gemeindeverwaltung, die zu dieser Zeit nur aus Bürgermeister Hirschmann (Hs.Nr. 71) bestand, mit verschiedensten öffentlichen Stellen abstimmen. Zu nennen sind hier insbesondere die Straßenbau-, Wasserwirtschafts- und Landwirtschaftsbehörden sowie das Vermessungs- und Katasteramt. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde von Hirschmann Johann - in enger Abstimmung mit dem Landratsamt - die Wege- und Gewässerplanung erstellt sowie eine Kostenschätzung vorgenommen.
Nach einer ersten Information der Teilnehmergemeinschaft (= alle Eigentümer der betroffenen Grundstücke / in Pavelsbach nahezu alle Anwesen) hat dann der Gemeinderat der Gemeinde Pavelsbach die Flurbereinigung beschlossen und diese, in Abstimmung mit dem Landratsamt Neumarkt, angeordnet. [66]
Die sehr umfangreichen Arbeiten (Feststellung der Bodenqualitäten des landwirtschaftlichen Ist-Bestands + Neuaufteilung + Neuvermessung + Eigentumsübertrag + Straßenplanung + Wege- und Grabenbau) bedeutete für Pavelsbach eine weitere Mammutaufgabe, zumal im Zuge dieses Verfahrens auch die innerörtlichen Kanal- und Entwässerungsanlagen sowie die Ortsstraßen gebaut wurden. [63]
Die vorausschauenden Planungen berücksichtigten dabei bereits die Gewerbe- und Sportflächen "An der Heide", die Erweiterungs- und Parkplatzflächen am Friedhof sowie die Spielplatz- und Grünflächen an der späteren Cäcilia- bzw. Leonhardstraße. Auch die Straßenführung des "Baugebiets Nord" (heute Marien- und Florianstraße) wurde im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens bereits festgelegt und herausgemessen.
Die Arbeiten dauerten insgesamt 6 Jahre und konnten noch in 1974 von der Gemeinde Pavelsbach zum Abschluss gebracht werden. [64]
Die Firma Schaller kommt in 1968 nach Pavelsbach [103]
(von Wolfgang Fries)
Der Feuchter Unternehmer Helmut Schaller hatte Anfang/Mitte der 1960er zusammen mit dem Unternehmer Kern die Jagd in Pavelsbach gepachtet. In dieser Zeit plante Helmut Schaller, aufgrund der guten Auftragslage seines Unternehmens, die Vergrößerung des in Feucht ansässigen Betriebes.
Diesbezüglich kam er auch mit dem damaligen Pavelsbacher Bürgermeister, Johann Hirschmann, ins Gespräch, der die sich bietende Chance sofort erkannte und der Firma Schaller ein maßgeschneidertes Grundstück "An der Heide" anbot. Die notwendigen gemeindlichen Erschließungsmaßnahmen wie Wasser-, Kanal- und Stromanschluss wurden vom Landkreis Neumarkt mit erheblichen Fördergeldern unterstützt.
In 1968 konnten die Baumaßnahmen abgeschlossen werden und das Unternehmen nahm in Pavelsbach die Produktion auf.
Seit rund 60 Jahren beherbergt Pavelsbach nunmehr den "Hidden Champion" im Bereich Gitarrenmechanik und Tonabnehmer. Gitarrenhersteller von Weltruhm wie Ovation, Gibson oder auch Fender verwenden nach wie vor u.a. auch von der Schaller GmbH hergestellte Teile.
Seit dem Ausscheiden der Familie Schaller in 2006 konnte der neue geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Lars Bünning, das Pavelsbacher Traditionsunternehmen zu alter Innovationskraft führen. Sein Verdienst ist es, dass auch heute noch eine Vielzahl von Pavelsbachern über einen tollen Arbeitsplatz bei der Firma Schaller GmbH verfügen. [103]
Gründung des Schulverbands 1969 [15] (von Wolfgang Fries)
Im Gasthaus Stiegler in Heng trafen sich am 21.08.1969 die Bürgermeister der damaligen Gemeinden Heng, Postbauer, Pyrbaum, Seligenporten, Oberhembach, Rengersricht und Pavelsbach und gründeten den Schulvernd der Volksschule Postbauer und Heng.
Ziel war der Bau einer gemeinsamen Volksschule für die Klassen 5 - 9 der Gemeinden Heng, Postbauer und Pavelsbach bzw. der Klassen 7 - 9 der Gemeinden Pyrbaum, Seligenporten, Oberhembach und Rengersricht.
Kommunale Gebietsreform [15] (von Wolfgang Fries)
Nachdem Ministerpräsident Alfons Goppel (CSU) in seiner Regierunserklärung vom 25.01.1967 die Reform angekündigt hatte, initiierte dann der damalige Innenminister Bruno Merk (CSU) diese durch Vorlage des Entwurfs für ein "Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" am 16.04.1970.
Bis 1972 wurden zunächst die Landkreise und die kreisfreien Städte neu geordnet. Ab 1972 erfolgte dies dann auf kommunaler Ebene.
Nachdem sich die beiden Gemeinden Heng und Postbauer bereits am 01.04.1971 zusammengeschlossen hatten, konnten am 02.03.1975 die wahlberechtigten Bürger der insgesamt 588 Einwohner Pavelsbachs entscheiden, ob sie sich dem Markt Pyrbaum, an die Gemeinde Berngau oder an die Gemeinde Postbauer-Heng anschließen wollen.
Da bereits damals eine Vielzahl von Pavelsbachern über den Bahnhof Postbauer nach Nürnberg zur Arbeit pendelten und sich Pavelsbach darüber hinaus in 1969 bereits dem Schulverband der Volksschule Postbauer und Heng angeschlossen hatte, wundert es nicht, dass 2/3 der wahlberechtigten Pavelsbacher für einen Anschluss an die Gemeinde Postbauer-Heng stimmten.
Pavelsbach ist seit dem 01.04.1975 daher ein Teil der heutigen Marktgemeinde Postbauer-Heng.
Noch im April 1975 wurden in Pavelsbach die neuen Straßennamen benannt. Die Vergabe der Hausnummern erfolgte dann ab dem 01. Juli 1975.
Die ersten gemeinsamen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen fanden am 01. Juni 1975 statt. Unter den 16 gewählten Gemeinderäten der Großgemeinde Postbauer-Heng waren 4 Pavelsbacher. Für die CSU waren dies Kneißl Ulrich (Hs.Nr. 75), Nunner Johann (Hs.Nr. 64), Walk Johann (Cä 1) und für die UPW Pogats Egon (Hs.Nr. 48).
Kneißl Ulrich wurde in der ersten Gemeindratssitzung am 11. Juni 1976 zum Dritten Bürgermeister der Großgemeinde Postbauer-Heng gewählt.
Bock kommt "An die Heide" [15]
(von Wolfgang Fries)
In 1978 erwarb das damals noch sehr übersichtliche und von Martin Bock geführte Unternehmen eine Grundstück "An der Heide" und errichtete dort die neue Firmenzentrale. Die Produktion verschiedenster Kunststoffteile konnte dort bereits in 1979 beginnen. Mittlerweile zählt die Bock GmbH & Co. KG zu den größten Firmen des Marktes Postbauer-Heng, ist weltweit tätig und besitzt weitere Produktionsstätten in Ungarn, China, Kanada und Mexico.
Volkstanzkreis [15] (von Wolfgang Fries)
Auf Initiantive des Ehepaares Hoppmann (Hoi) und der Familie Lehner (Hs. Nr. 1) hin wurde am 08.03.1979 der Volkstanzkreis gegründet. Von Anfang an machten es sich die Akteure zur Aufgabe, die alten Volkstänze der Oberpfalz zu pflegen.
25 Jahre Blaskapelle Pavelsbach [26] (von Wolfgang Fries)
Vom 24. bis 27. Mai 1979 wurde das Jubiläum der Blaskapelle im Festzelt auf der Wiese beim Härteis groß gefeiert. Insbesondere der Gemeinschaftschor von 8 Blaskapellen war ein tolles Erlebnis. Näheres siehe auch unter "Vereine". [26]
IREMA Filter jetzt "An der Heide" [15]
(von Wolfgang Fries)
Das in 1975 von Inge und Reinhard Jung in Nürnberg gegründete Unternehmen zog im Jahre 1980 an den neuen Firmensitz "An der Heide". Damit begann auch die Erfolgsgeschichte der Firma IREMA Filter, die mittlerweile diverse Filter- und HEPA-Medien für die Industrie und den Gesundheitssektor herstellt und weltweit vertreibt. Vor über zwanzig Jahren kam eine weitere Produktions- und Vertriebsstätte in den USA hinzu. Seit 2016 wird das Unternehmen von der 2. Generation, von Anke Jung und Andreas Seeberger mit großem Erfolg geleitet und zählt mittlerweile zu den größten in Postbauer-Heng ansässigen Unternehmen.
Pavelsbach bekommt einen Kindergarten [159] (von Wolfgang Fries)
Am 01. Mai 1980 wurde der Kindergarten Pavelsbach unter großer Beteiligung der Pavelsbacher Bevölkerung eingeweiht. Neben dem Bürgermeister und den Vertretern der Gemeinde nahmen an dem Festakt, der vom Kirchenchor und der Blaskapelle musikalisch begeiltet wurde, auch die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine teil. Im Anschluss an die offiziellen Festreden erteilte Pfarrer Burzdzius dem erweiterten, ehemaligen kleinen Schulhaus den kirchlichen Segen.
Nachdem in Pavelsbach bereits in den Jahren 1928 bis 1938 ein Kindergarten im Vereinshaus untergebracht war, können die Kleinkinder Pavelsbachs - nach über 40 Jahren - wieder im Dorf selbst betreut und gefördert werden.
Pavelsbachs Ortsmitte wird bebaut [159] (von Wolfgang Fries)
Mitte des Jahres 1980 wurde mit den Erschließungsarbeiten am sogenannten "Fleegaggá" begonnen. Bereits vor Fertigstellung aller notwendigen Anschlüsse - in 1980 - wurden erste Wohnbaumaßnahmen in Angriff genommen. Mit der Bebauung der heutigen Theresien- und Stefanstrasse wurde die bis dahin bestehende Baulücke zwischen dem Pavelsbacher Ober- und Unterdorfs endgültig geschlossen.
Spielplatz im Ortszentrum [159] (von Wolfgang Fries)
Mitte des Jahres 1982 wurde der neu errichtete Spielplatz zwischen der Cäciliastrasse und der Stefanstrasse - beim Buswartehäuschen in der Cäciliastrasse - seiner Bestimmung übergeben.
Fuß- und Radweg in die Hoi [159] (von Wolfgang Fries)
Zwischen Pavelbach und dem Sport- und Gewerbegebiet "An der Heide" wurde Ende des Jahres 1982 der neu erbaute Fuß- und Radweg zur Nutzung freigegeben.
Gründung des OGV Pavelsbach [15] (von Wolfgang Fries)
1984 wurde der Obst- und Gartenbauverein aus der Taufe gehoben. Der Verein arbeitet seither unermüdlich an der Verschönerung des Dorfes und tut sich bei kirchlichen und weltlichen Festen beim arrangieren des Blumenschmucks hervor. Als Initiator und Veranstalter des pavelsbacher Kartoffelfestes tut der Verein auch viel für die Traditionspflege im Ort.
Der letzte Pavelsbacher Geistliche wird verabschiedet [28]
(von Wolfgang Fries)
Am Sonntag den 28.05.1989 wurde Pfarrer Josef Burzdzius nach 26jähriger Tätigkeit als Seelsorger in der Expositur Pavelsbach in den Ruhestand verabschiedet. Dies geschah im Rahmen eines Festgottesdienstes, der vom Kirchechor und der Blaskapelle musikalisch gestaltet wurde und an dem die Amtsbrüder Pfarrer Bussinger (Postbauer-Heng), Pater Vinzenz (Seligenporten), Pfarrer Gottschalk (Möning) sowie der Dekan Lang aus Woffenbach teilnahmen.
Für die Pfarrgemeinde sprach Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Pröpster (Hs. Nr. 70) herzliche Worte des Dankes, in denen er die Außen- und Innenrenvierung der beiden Kirchen St. Cäcilia und St. Leonhard als bleibende Verdienste des scheidenden Pfarrers herausstellte.
Zusammen mit Kirchenpfleger Michael Leitl (Hs. Nr. 17) überreichte er im Auftrag von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung eine in Öl gemalte Ansicht von Pavelsbach als Abschiedsgeschenk. [28]
Neubau des Feuerwehrhauses 1988/1989 [36] (von Wolfgang Fries)
Die Großgemeinde Postbauer-Heng beschloss Anfang 1988 die Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses, da sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehr in den Vorjahren deutlich ausgeweitet hatte. Der Neubau wurde im Mai 1988 in der Theresienstraße in unmittelbarer Nähe zur Dorfkirche St. Leonhard begonnen. Zwar wurde der Robau von der Gemeinde an Baufirmen übergeben, beim Innenausbau jedoch haben sich die pavelsbacher Bürger mit 1.500 freiwilligen Arbeitsstunden an der Fertigstellung des Hauses beteiligt. Errichtet wurde das neue Feuerwehrhaus im Stile früherer, großer Bauernhäuser, damit dieser Baustil in Pavelsbach auch in Zukunft noch sichtbar bleibt.
Das Feuerwehrhaus wurde für das Dorf als zentrales Gebäude konzipiert, dass neben der Feuerwehr auch der Rotkreuzgruppe und der Blaskapelle Pavelsbach eine Heimat bietet. Auch der Kirchenchor nutzte anfangs den Probenraum der Blaskapelle für die "Singstunden". Der Gebäudekeller wird von Anfang an vom TSV Pavelsbach als Gymnastikraum genutzt.
Am 10.09.1989 überreichte dann Bürgermeister Hans Bradl die Schlüssel des Hauses an Feuerwehrvorstand Stefan Riehl. Im Anschluß spendeten die beiden Pfarrer Josef Burzdzius und Johann Gottschalk dem neuen Feuerwehrhaus den kirchlichen Segen.
Wie es in Pavelsbach gute Tradition ist, wurde dieses Ereignis mit einem großen Fest gefeiert.
Sparkasse Pavelsbach [141] (von Wolfgang Fries)
Nach nur dreimonatiger Bauzeit konnte am 02. Januar 1991 im Kesslwiád-Anwesen (Ludwigstraße 16) die Sparkassenfiliale Pavelsbach ihre Pforten öffnen.
Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Hans Gottschalk aus Möning. Ehrengäste der Eröffnungsfeier waren Sparkassenvorstand Karl-Heinz Stöckle, Landrat Kurt Romstöck und der Dritte Bürgermeister von Postbauer-Heng, Johann Nunner.
Im Anschluß an die Einweihung überreichte Franz Graf, der langjährige Leiter dieser Filiale, den Vorständen der SKK Pavelsbach, des Schützenvereins "Eichenlaub", der Feuerwehr sowie des OGV und auch der Kirchenstiftung Pavelsbach jeweils eine Spende. [141]
(Fotos und Zeitungsartikel wurden dankenwerterweise von der Sparkasse zur Verfügung gestellt. Besonderer Dank gilt Herrn Friedrich Meier von der Abteilung Vertrieb/Marketing)
110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pavelsbach [37] (von Wolfgang Fries)
Am Sonntag den 26. Juni 1994 zelebrierte, in dem von den Damen des Obst- und Gartenbauvereins festlich geschmücketen Gotteshaus, Pfarrer Johann Gottschalk einen Jubiläumsgottesdienst, dem sich am Kriegerdenkmal die Totenehrung für alle gefallenen und verstorbenen Feuerwehrangehörigen anschloß.
Danach zogen die "Offiziellen" zusammen mit den Pavelsbacher Ortsvereinen und den Patenwehren aus Loderbach, Woffenbach, Röckersbühl, Heng und Pyrbaum zu den Klängen der Blaskapelle Pavelsbach in einem langen Festzug vom Feuerwehrhaus zum Vereinslokal Schrödl. Dort wurden langjährig aktive Wehrmänner vom Kreisbrandrat Karl Regnat und dem stellvertretenden Landrat Kurt Romstöck für ihren Dienst an der Allgemeinheit ausgezeichnet.
Zur Erinnerung an dieses Vereinsjubiläum wurde vor dem Feuerwehrhaus nebenstehendes Foto vom Ehrenkommandanten Johann Distler, der Vereinsführung und den aktiven Feuerwehrlern Pavelsbachs geschossen.
FCN-Fanclub Rot-Schwarzes Herz Pavelsbach [15] (von Wolfgang Fries)
Am 14.06.2002 fand die Gründungsversammlung des Vereins im Sportheim des TSV statt. Der Verein steht unter dem Motto: "Ob Liga eins, zwei oder drei, das Rot-Schwarze Herz ist immer dabei". Weitere Infos unter https://www.fcn.de/fans-mitgliedschaft/ofcn/liste/club/rot-schwarzes-herz-pavelsbach/
Eröffnung des Dorfmuseums Fleischmichlhaus [31]
(von Wolfgang Fries)
Am 29. September 2002 öffnete das Pavelsbacher Dorfmuseum erstmals seine Pforten. Das neue kulturelle Angebot wurde von der Bevölkerung Pavelsbachs und auch der Nachbargemeinden gut angenommen und hat in den folgenden "Öffnungs-Sonntagen" sehr viele Besucher aus Nah und Fern angezogen. (Details zum Fleischmichlhaus siehe "Sehensw.")
Für verschiedene Gruppen wurden darüber hinaus von Paula und Josef Pröpster Sonderführungen veranstaltet. Auf mehrfachen Wunsch hin wurde das Museum dann auch am 05. Januar 2003 für eine kleine Sonderausstellung "Spielzeug aus der Kinderzeit" geöffnet. Hierzu wurde in der gemütlichen Stube zu Glühwein eingeladen.
Sparkasse Pavelsbach wird geschlossen [87]
(von Wolfgang Fries)
Die Sparkasse Neumarkt hat im Januar 2003 der Gemeinde mitgeteilt, dass die seit 1991 beim Kesslwiád untergebrachte Zweigstelle Mitte des Jahres aufgegeben wird. Nach Angaben der Sparkasse konnte die zuletzt noch als Selbstbedienungsstelle betriebene Filiale keine Kostendeckung mehr erreichen.
Nebengebäude am Fleischmichlhaus [40] (von Wolfgang Fries)
Neben dem Wohnstallhaus und der Scheune hat die Berufsschulklasse der Zimmerer aus Neumarkt einen sogenannten Saukobl (keiner Schweinestall) errichtet. Bürgermeister Hans Bradl lud die jungen Handwerker am 30.06.2003 zum Dank zu einem kleinen Richtfest ein.
Verwendung fand dort Baumaterial, das bis 1975 in Heng in einem Schweinestall verbaut war, der aufgrund seiner handwerklich wertvollen Gestaltung von der Gemeinde abgetragen und eingelagert worden war.
Unter Anleitung des Berufsschullehrers Alfons Kratzer aus Postbauer-Heng zeigten die jungen Handwerker eindrucksvoll, dass sie auch mit alten Baumaterialien hervorragend umgehen können.
Einweihung des Kindergartenneubaus am 13. September 2003 [32]
(von Wolfgang Fries)
Die erst im März 2003 begonnen Bauarbeiten konnten bereits Ende Juli abgeschlossen werden. Dabei wurde das ehemalige "kleine" Schulhaus in den Neubau integriert und dient seither den Kindergartenkindern als Turnhalle und wird darüber hinaus als Wahlraum für Pavelsbach genutzt. Die kalkulierten Baukosten für sämtliche Baumaßnahmen summierten sich auf insgesamt 414.000,00 Euro.
Am 13.09.2003 zogen dann die Kindergartenkinder mit den Betreuerinnen zusammen mit den Vertretern der Großgemeinde, den Ortsvereinen und einem großen Teil der Pavelsbacher Bevölkerung in einem festlichen Zug von der Kirche zum neuen Kindergarten.
Nach dem kirchlichen Segen wurde das Namensschild am Kindergarten enthüllt und alle Kindergartenkinder riefen ganz laut "Lummerland".
Neues Buswartehaus in der Simonstraße [88] (von Wolfgang Fries)
Im Rahmen der Dorferneuerung wurde das über 20 Jahre alte Buswartehaus in der Simonstraße im November 2003 erneuert. Dank gilt dem Freistaat Bayern, der diese Maßnahme gefördert hat.
Die Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug [41] (von Wolfgang Fries)
Am Samstag den 16. April 2005 fanden sich die Feuerwehrkameraden Pavelsbachs und sämtliche Ortsvereine um 17:30 Uhr am Feuerwehrhaus ein und zogen dann gemeinsam in einem Kirchenzug zur St. Leonhard-Kirche zu einem Festgottesdienst. Im Anschluss begab sich die gesamte Gemeinde zurück zum Feuerwehrhaus, wo Pfarrer Albert Beyer dem neuen Fahrzeug den kirchlichen Segen spendete. Nach Grußworten des Landsrats Albert Löhner und des Bürgermeisters Hans Bradl überreichte dieser die Fahrzeugschlüssel an den Kommandanten Thomas Härtl.
Der Tag endete mit einem Kameradschaftsabend mit gemeinsamen Essen im Feuerwehrhaus. Musikalisch umrahmt wurden die Festlichkeiten von der Blaskapelle Pavelsbach.
Das neue Löschfahrzeug "LF 10/6" MAN/Schlingmann, dass rd. 190.000,00 € kostete und seine "Feuertaufe" bereits am 17.12.2004 bei einem Wohnungsbrand in Kemnath mit Bravour bestand, verbessert den Fahrzeugpark der Pavelsbacher Wehr deutlich.
Neugestaltung des Spielplatzes [143] (von Wolfgang Fries)
Im November 2005 wurde auf Anregung einer Elterninitiative der Spielplatz in Pavelsbach an der Cäciliastraße um einen Spiel- und Kletterbereich erweitert. Die Planungen übernahm die Kreisfachberaterin für Gartenkultur am Landratsamt Neumarkt/Opf. Neben der Kostenübernahme über EUR 5.000,00 durch den Markt Postbauer-Heng trugen auch Spenden in Höhe von EUR 800,00 zur Finanzierung der Ertüchtigung bei. [143]
An der Heide wird ein Ortsteil [44] (von Wolfgang Fries)
Im März 2006 wurde aus der Pavelsbacher Hoi der Ortsteil "An der Heide", da die bis dahin verwendete Bezeichnung "Pavelsbach An der Heide" von der Regierung der Oberpfalz nicht genehmigt wurde.
Neues Baugebiet Michaelstraße [45] (von Wolfgang Fries)
Bereits in der Sitzung 07.11.2005 hat der Marktgemeinderat Postbauer-Heng die Aufstellung des betreffenden Bebauungsplans beschlossen. Die Auflegung dieses Plans von 5 Bauplätzen am nördlichen Ortseingangs von Pavelsbach erfolgte in der Zeit vom 25.11. - 28.12.2005 und - nach Überarbeitung - vom 13.04. - 15.05.2006.
Verbesserung der Kläranlage Pavelsbach [142] (von Wolfgang Fries)
Die im Oktober 2005 begonnenen Baumaßnahmen zur Verbesserung der Kläranlage wurden im Juni 2006 abgeschlossen. Am 27.07.2006 wurde die erneuerte Kläranlage um 11:00 Uhr in Betrieb genommen. Die Gesamtkosten für die umfangreichen Maßnahmen summierten sich auf insgesamt EUR 880.000,00. Die gemeindlichen Bescheide für die Verbesserungsbeiträge wurden dann im August 2006 an die Grundstückseigentümer Pavelsbachs versandt. [142]
100 Jahre Schützenverein Eichenlaub Pavelsbach [47]
(von Wolfgang Fries)
Die Festlichkeiten fanden vom 21. bis 23.07.2006 im Festzelt an der Paulstraße statt.
Am Freitag den 21. Juli begann das Fest mit der bekannten Indie-Coverband "El Loco" und der Vorgruppe "Cycle Stage".
Am Samstag den 22. Juli folgte dann ab 19 Uhr das Große Böllerschießen und im Anschluss der Festabend mit den "Rothsee-Musikanten"
Der Sonntag begann dann schon um 7:30 Uhr mit dem Weckruf und der Einholung der Patenvereine. Danach zogen der Jubelverein, die Patenvereine und die Ortsvereine vom Festplatz an der Paulstraße in einem feierlichen Zug zur Kirche zu einem gemeinsamen Festgottesdienst und Totengedenken. Der Frühschoppen mit der Blaskapelle Pavelsbach fand dann wieder im Festzelt statt.
Um 14 Uhr stellte sich eine große Anzahl von Schützenvereinen zum Festzug durch das Dorf auf. Im Anschluss wurden dann der Einzug der Fahnen ins Festzelt von der Blaskapelle Pavelsbach begleitet.
Ab 19:00 Uhr spielte die "Steirer Music Company" zünftig auf und die "Stoakreizplattler" aus Kadenzhofen zeigten ihr Können
Bebauungsplan zur Verlängerung der Ottostraße [139]
(von Wolfgang Fries)
Nach Billigung des geänderten Bebauungsplans wurden die Unterlagen vom 23.01.-24.02.2009 im Rathaus öffentlich ausgelegt. Die Verlängerung der Ottostraße ermöglicht die Bebauung mit 4 weiteren Wohnhäusern. [139]
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pavelsbach [92]
(von Wolfgang Fries)
Vom 10. bis 12. Juli 2009 hat die FF Pavelsbach das Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert. Details siehe Festschrift "125 Jahre FF Pavelsbach"
Kanalsanierungsmaßnahmen in Pavelsbach [144] (von Wolfgang Fries)
Nach dem Beginn der Untersuchung des Pavelsbacher Kanalnetzes hat das beauftragte Ingenieurbüro SRP Schneider & Partner aus Zeil am Main erste Ergebnisse präsentiert. Am 28.05.2008 fand dazu eine Besprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit dem Bau- und Umweltausschuss des Marktes Postbauer-Heng statt. Im Anschluss wurde die ersten Baumaßnahme, die dauraus umgesetzt werden soll, besichtigt. Durch einen Gebäudeabriss auf einem Privatgrundstück wird der Bau eines neuen Abwassersammlers von der Ludwigstraße zum Lohgraben ermöglicht, da die alte Sammelleitung schadhaft und zu gering dimensioniert war. [144]
Breitband für Pavelsbach [46] (von Wolfgang Fries)
In der Bürgerversammlung vom 14.11.2007 beim Schrödl wurde der aktuelle Stand der Breitbandversorgung Pavelsbachs abgefragt. Hierzu wurde von Bürgermeister Kratzer auf das Schreiben der Deutschen Telekom vom 03.02.2006 verwiesen, die für eine Erschließung Pavelsbachs einen Gemeindeanteil von € 50.000 fordert. Im August 2008 wurde die Förderungsfähigkeit der Maßnahme festgestellt. Ab August 2009 konnte dann vom Pavelsbacher Unternehmen Brandl Services GmbH eine Breitband Funklösung in Pavelsbach und An der Heide angeboten werden.
Fertigstellung des "Kreisverkehrs An der Heide"[82] (von Wolfgang Fries)
In der ersten Augustwoche 2010 konnten die im Mai begonnen Arbeiten abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten von 411.000,00 EUR teilten sich zum größten Teil das Staatliche Bauamt und der Landkreis Neumarkt.
Das Dorfgebiet Pavelsbach wird erweitert [145] (von Wolfgang Fries)
Im Januar 2011 hat der Marktgemeinderat beschlossen das "Dorfgebiet Pavelsbach" um eine Teilfläche von ca. 1.700 m² zu erweitern. Mit Einverständnis des Wasserwirtschaftsamtes und der Naturschutzbehörde wurde ein weiterer Bereich der Ottostraße Baugebiet. [145]
Pavelsbach bekommt Glasfaser [83] (von Wolfgang Fries)
Am 13.06.2011 wurde für Pavelsbach und die Hoi eine direkte Glasfaserverbindung über Seligenporten bis nach Nürnberg geschaltet. Nach längeren Baumaßnahmen kann die Firma Brandl Services GmbH den Pavelsbachern nunmehr Anschlüsse mit höchsten Übertragungsraten bieten. Hinsichtlich der Glasfaserversorgung nimmt Pavelsbach in Deutschland somit eine Spitzenposition ein und überflügelt sogar Metropolen wie Riga, New York oder Sydney.
Wasserleitung Paulstraße [91] (von Wolfgang Fries)
Aufgrund von vielfachen Rohrbrüchen hat der Zweckverband Möniger Gruppe die Erneuerung der Wasserleitung Paulstraße zwischen der Sebastianstraße und der Josefstraße vorgenommen. Die Hauptwasserleitung wurdde grabenlos verlegt, so dass nur für die Hausanschlüsse und die Kreuzungen aufgegraben werden musste. Die Arbeiten wurden Ende November 2011 abgeschlossen.
Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Seligenporten [84]
(von Wolfgang Fries)
Im Auftrag des Marktes Postbauer-Heng hat die Firma Pusch Bau GmbH & Co. KG die Gemeindeverbindungs-straße zur ST 2402 verbreitert und zugleich den Oberbau des Straßenbauwerks verstärkt. Nach fristgerechter Bauzeit von 6 Wochen wurde die 1,28 km lange Strecke am 31.05.2012 wiedereröffnet. Die Kosten in Höhe von insgesamt € 279.000,00 wurden vom Regierungsbezirk Oberpfalz mit € 100.000,00 gefördert.
Erschließung Ottostraße [146] (von Wolfgang Fries)
Der Neubau einer Ringschluss-Leitung zwischen den bisher vorhandenen Stichleitungen sowie der Kanalbau wurde im Juni 2012 vom Zweckverband Möninger Gruppe sowie dem Markt Postbauer-Heng beauftragt. Kanal und Wasserleitung werden von der Firma Strabag aus Regensburg verlegt. Die Kosten belaufen sich für den Kanal auf EUR 39.350,29 und für die Wasserleitung auf EUR 29.042,43. [146]
Neue Straßenbeleuchtung [90] (von Wolfgang Fries)
Die in die Jahre gekommenen Pilzleuchten auf Kunststoffmasten werden ab 2014 nach und nach durch LED-Leuchten ersetzt, die auf Stahlmasten montiert sind. Bei den neuen Lampen handelt es sich um die Leuchte Philips Mini Iridium mit einer Weitstrahloptik. Diese sorgt dafür, dasss das LED-Lich nicht so scharf gebündelt ist, sondern etwas mehr Streulicht aufweist. Die Kosten belaufen sich auf rd. 1.500 € je Lampe.
Erneuerung der Paulstraße [90] (von Wolfgang Fries)
Am 25. August 2014 hat die Fa. Feierler aus Röckersbühl mit der Erneuerung der Deckschicht begonnen. Zunächst wurde der alte Fahrbahnbelag abgefräst und dann die neue Deckschicht aufgebracht. Während dieser Arbeiten kam es zu einer Vollsperrung der Paulstraße.
Flugfreunde Pavelsbach e.V. [85] (von Wolfgang Fries)
Am 18. November 2014 wird der neue Verein im Register (VR 201712 AG Nürnberg) eingetragen. Vertreten wird der Flugverein von Monika Boos und Christian Brandl. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, bei Pavelsbach eine Landebahn zu verwirklichen.
Sonderlandeplatz Pavelsbach [86] (von Wolfgang Fries)
Mit Bescheid vom 19.01.2016 hat die Regierung von Mittelfranken (Luftamt Nordbayern) die luftrechtliche Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb des Sonderlandeplatzes "Nähe Pavelsbach" erteilt. Damit darf der Verein "Flugfreunde Pavelsbach e.V." Flüge nach den Sichtflugregeln (bei Tage) durchführen.
Gewerbegebiet An der Heide West [101] (von Wolfgang Fries)
Der Marktgemeinderat Postbauer-Heng hat am 10.03.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet An der Heide West" beschlossen. Vom 01.04.-14.05.2025 fand dann die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Fachbehörden statt. Die zahlreichen Hinweise der Fachbehörden flossen in die überarbeitete Fassung des Bebauungsplans ein, die der Marktgemeinderat in seiner Juli-Sitzung beschlossen hat. [101/Seite 5]
Wir erstellen gerade weitere Inhalte zur Geschichte Pavelsbachs. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!
Quellen und Einzelnachweise:
[1] Broschüre "250 Jahre Kirche St. Leonhard Pavelsbach" / Herausgeber: Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Pavelsbach aus 1986 / Autor: Kreisheimatpfleger des Landkreises Neumarkt/Opf. Oberstudienrat Herbert Lang, Neumarkt
[2] Historischer Atlas von Bayern; abgerufen am 24.01.2024 in bavarikon (bereitgestellt von der Bayerischen Staatsbiliothek München, 1967) Autor: Bernhard Heinl
[3] Bayer. Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; Geschichte der Vermessung in Bayern abgerufen am 28.01.2024 LINK: https://www.ldbv.bayern.de/ueberuns/ldbv/geschichte.html
[4] Franz Heidingsfelder: Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt. Hrsg.: Gesellschaft für fränkische Geschichte. 1. Auflage. VI. Reihe, III. Lieferung (Bogen 21-30). Verlag der Wagner'schen K.K. Universitäts-Buchdruckerei, R. Kiesel, Innsbruck Januar 1917, S. 234. LINK: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8292433 Dort dann bei LINKS die PDF aufrufen und auf Seite 234 gehen.
[5] Simon Federhofer: Herrschaftsbildung im Raum Neumarkt : Historischer Verein Neumarkt i.d.Opf. und Umgebung e.V. Neumarkt i.d.Opf : Druckerei Fuchs, Berching-Pollanten
[6] Franz Heidingsfelder: Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt. Hrsg.: Gesellschaft für fränkische Geschichte. 1. Auflage. VI. Reihe, IV. Lieferung (Bogen 31-40). Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchdruckerei, Innsbruck Januar 1921, S. 261. LINK: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8292446 Dort dann bei LINKS die PDF aufrufen und auf Seite 261 gehen.
[7] Dr. Josef Seger: Der Bauernkrieg im Hochstift Eichstätt / Herausgeber (Nachdruck): Initiative Mässinger Haufen 1525
[8] Sammelband 775 Jahre Seligenporten / Herausgeber: Markt Pyrbaum / Verfasser: Verschiedene Texte Marktarchiv Pyrbaum / Druck: Kilian Druck Nürnberg / Dezember 2017
[9] Roland Heinisch: "Herrschaft des Deutschen Ordens im Pflegamt Postbauer von 1271 - 1805" / Herausgeber: Gemeinde Postbauer Heng / Druck: Kilian Druck Nürnberg / Juni 1996
[10] Broschüre "Friedhofskirche St. Cäcilia Pavelsbach" / Herausgeber: Pfarrgemeinderat Pavelsbach aus 2015 / Autor: Hans Pröpster Pavelsbach / Druck: Fuchs GmbH, Pollanten
[11] Heribert Batzl: Chronik der Gemeinde Postbauer-Heng / Herausgeber: Gemeinde Postbauer-Heng 1977
[12] Menschen im Krieg. Die Oberpfalz von 1618 bis 1648 / Staatliche Archive Bayerns- Kleine Ausstellungen Nr. 58 - Eine Ausstellung des Staatsarchivs Amberg / Herausgeber: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayern / Druck: OrtmannTeam GmbH, Ainring ISBN 978-3-938831-85
[13] Einiges vom Dreißigjährigen Krieg / Posted by freyhammer in 30jähriger Krieg, Gegenreformation, Geschichte und Kulturgeschichte, Oberpfalz / Aus den Kriegsakten des Staatsarchivs Amberg Von Generalmajor a. D. Dollacker / https://freyhammer.wordpress.com/2018/05/25/einiges-vom-dreissigjaehrigen-krieg/
[14] Historisches Lexikon Bayerns / Bayerische Staatsbiliothek München / abgerufen über bavarikon am 04.02.2024 https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Gemeindeverfassung_(19./20._Jahrhundert)#Gemeindeedikt_von_1818
[15] Dr. Ing. Helmut Bode, Hans Bradl, Hans Pröpster, Paula Pröpster, Jens Liebl: Markt Postbauer-Heng Seine Geschichte, Geschichten und Ortschaften / Zusammengefasst vom "Arbeitskreis Heimatpflege" / Herausgeber: Markt Postbauer-Heng
[16] Johann Nepomuk Reichsfreiherr von Löwenthal: Geschichte des Schultheißenamts und der Stadt Neumarkt auf dem Norgau oder in der heutigen obern Pfalz / Herausgeber: Nikolaus Thadäus Gönner im August 1805
[17] Zitate aus: Das Bistum Eichstätt / Historisch-statistische Beschreibung, auf Grund der Literatur, der Registratur des Bischöflichen Ordinariats Eichstätt sowie der pfarramtlichen Berichte / II. Band / Franz Xaver Buchner Domkapitular in Eichstätt / Druck und Kommisionsverlag: Ph. Brönner- & M. Däntler'sche Buchdruckerei / Eichstätt 1938
[18] Bericht des pavelsbacher Altbürgermeisters Johann Hirschmann vom 31.07.1976
[19] Hans Pröpster Pavelsbach: Geschichte der Kirche und der Seelsorgestelle in Pavelsbach
[20] Franz Heidingsfelder: Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt. Hrsg.: Gesellschaft für fränkische Geschichte. 1. Auflage. VI. Reihe, III. Lieferung (Bogen 21-30). Verlag der Wagner'schen K.K. Universitäts-Buchdruckerei, R. Kiesel, Innsbruck Januar 1917, S. 234. LINK: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8292433 Dort dann bei LINKS die PDF aufrufen und auf Seite 174 gehen.
[21] Protokollbuch des Vereins katholischer landwirtschaftlicher Arbeiter in Pavelsbach
[22] Festschrift 125 Jahre Freiwilligen Feuerwehr Pavelsbach aus 2009 / Herausgeber FF Pavelsbach / Druck: Druckerei Bögl, Neumarkt
[23] Festschriften zu den 90 und 100-jährigen Gründungsjubiläen des Schützenvereins
[24] Ermittlungsbericht mit diversen Zeugenaussagen des Bezirksamts Neumarkt vom 27.07.1928 zum Großbrand in Pavelsbach am 04.07.1928
[25] Nürnberger Polizeiordnungen aus dem XIII bis XV Jahrhundert / hrsg. von Joseph Baader. - Photomechan. Nachdr. d. Ausg. Stuttgart 1861. - Amsterdam : Rodopi, 1966. - 340 S. (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart ; 63) (=BiblLitV.)
[26] Festschrift der Blaskapelle Pavelsbach zum 25-jährigen Gründungsjubiläum 1979 / Zeitungsartikel NN und Tagblatt vom 31.05.1979
[27] Mayerhöfer Nikolaus - Die Geschichte von Möning Seite 75 aus Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg (30ter Band aus 1874)
[28] Zeitungsbericht im Neumarkter Tagblatt vom 02.06.1989
[29] Aufzeichnungen der Paula Pröpster
[30] Beiträge zur Heimatpflege 1 / Markt Postbauer-Heng / von Ortsheimatpfleger Josef Lobenhofer
[31] Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng im Dezember 2002
[32] Mitteilungsblätter der Gemeinde Postbauer-Heng Dezember 2002 + Februar/März/August 2003
[33] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng im März 2012
[34] F. X. Buchner, Eichstätt „Schulgeschichte bis 1800“ 1957 / Aufzeichnungen im „Notizenbuch der Schule Pavelsbach“ /
Aufzeichnungen des ehem. Pavelsbacher Schulleiters Anton Fruth
[35] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Mai 2013 (Quelle Archiv des Marktes Postbauer-Heng)
[36] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng August 2014 / Heimatpflege / Autor Hans Bradl
[37] Jubiläumsfestschrift der FF Pavelsbach / Bericht Neumarkter Tagblatt vom 01.07.1994
[38] Website: Wikipedia Bahnstrecke Regensburg - Nürnberg sowie Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng Februar 2003 / Heimatpflege / Erstellt von Ferdinand List, Heimatpfleger Postbauer-Heng
[39] Website: Wikipedia Bahnstrecke Burgthann - Allersberg
[40] Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng Juli 2003
[41] Mitteilungsblätter der Gemeinde Postbauer-Heng September 2003 + Januar 2004 + Februar 2004 + März 2005 / NN vom 16.03.2005 - Lokalteil Seite 3
[42] Franz Heidingsfelder: Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt. Hrsg.: Gesellschaft für fränkische Geschichte. 1. Auflage. VI. Reihe, III. Lieferung (Bogen 21-30). Verlag der Wagner'schen K.K. Universitäts-Buchdruckerei, R. Kiesel, Innsbruck Januar 1917, S. 174. LINK: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8292444 Dort dann bei LINKS die PDF aufrufen und auf Seite 174 und 234 gehen.
[43] Kurt Romstöck: Geschichte des Neumarkter Landkreises
[44] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng Februar + Mai + Juli 2005 / Januar + März 2006
[45] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng November 2005 / April + Juni 2006
[46] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng Mai + Juli 2006 / Dez. 2007 / Aug. 2008 / Feb. + Aug. 2009
[47] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng Juli 2006
[48] Website: Wikipedia Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung
[49] Website: Wikipedia Erster Weltkrieg
[50] Website: Wikipedia Zweiter Weltkrieg
[51] Website: Wikipedia Deutsch-Französischer Krieg
[52] Website: Wikipedia Deutsche Reichsgründung
[53] "Gesetz vom 29. April 1869, die Gemeindeordnung für die Landestheile diesseits des Rheins betr.", abgerufen im Internet: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10373744?page=2,3
[54] Website: Wikipedia Jagdgenossenschaft
[55] Website: Wikipedia Schwarzer_Tod
[56] Zeitungsbericht im Neumarkter Tagblatt vom 19.02.1988
[57] Website: Wikipedia https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Karte_Sulzb%C3%BCrg_-_Pyrbaum_1748.jpg
[58] Gerhard Pfeiffer: Die ältesten Urbare der Deutschordenskommende Nürnberg / Kommisionsverlag Degener & Co. Neustadt/Aisch 1981
[59] Aufzeichnungen der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Pavelsbach
[60] Website: Wikipedia Neolithische Revolution
[61] Website: Wikipedia Mittelsteinzeit
[62] Festschrift der Blaskapelle Pavelsbach zum 25-jährigen Gründungsjubiläum 1979
[63] Zeitungsartikel Neumarkter Tagblatt vom 03.01.1959 + 12.02.1963
[64] Ausführlicher Artikel in Landkreis-Zeitschrift Ansporn: https://www.landkreis-neumarkt.de/download/a4o1lekr9mb71ugmsn23cfavv9n/ansporn01_2020.pdf
[65] Website: Wikipedia Express Werke
[66] Website: Wikipedia Flurbereinigung_(Deutschland)
[67] Website: Wikipedia Viereckschanze
[68] Website: Wikipedia Zweiter Markgrafenkrieg -- Fürstenaufstand
[69] Website: Althochdeutsches Wörterbuch abgerufen unter: https://awb.saw-leipzig.de/?sigle=AWB&lemid=K00850
[70] Website: Wikipedia Geschichte der Oberpfalz
[71] Website: Wikipedia Mannlehen
[72] Website: Wikipedia Deutscher_Bauernkrieg
[73] Website: Wikipedia Reformation
[74] Website: Wikipedia Spanisches Kolonialreich
[75] Website: Wikipedia 16._Jahrhundert
[76] Website: Wikipedia Eisenzeit + Latenezeit + Urnenfelderkultur
[77] Website: BayernAtlas / Thema Bodendenkmäler / abgerufen am 26.01.2025 unter https://atlas.bayern.de/?c=670601,5460891&z=15.54&r=0&l=atkis,6f5a389c-4ef3-4b5a-9916-475fd5c5962b,d0e7d4ea-62d8-46a0-a54a-09654530beed&l_v=true,true,false&t=pl_bau
[78] Website: Ortsgeschichte Seligenporten
[79] Artikel in der kirchlichen Zeitschrift "St. Willibalds-Bote" vom 12. Februar 1939
[80] Münchener Bote Nr. 230 vom 29.09.1869 abgerufen am 04.02.2025 bei Münchener DititalisierungsZentrum Digitale Bibliothek
[81] Alfred Wolfsteiner / Die Pest in der Oberpfalz / Aus der Reihe: Oberpfälzer Raritäten Band 6
[82] Mitteilungsblätter der Marktemeinde Postbauer-Heng August 2009 + Januar 2010 + Juli 2010
[83] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng April 2011 + Juni 2011
[84] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng Februar 2012 + Juni 2012
[85] Vereinsregisterauzug Nr. VR201712 des Amtsgerichts Nürnberg
[86] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Februar 2016
[87] Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng Januar 2003
[88] Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng November 2003
[89] Mitteilungsblatt der Gemeinde Postbauer-Heng November 2005 / Artikel zur Auflösung des Deutsch Ordens Pflegamtes Postbauer vor 200 Jahren / Prof. Dr.-Ing Helmut Bode
[90] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng August 2014
[91] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng September 2011
[92] Festschrift zu 125 Jahre FF Pavelsbach, abgerufen http://www.feuerwehr-pavelsbach.de/Festschrift.pdf
[93] Website: Wikipedia Polnischer Thronfolgekrieg
[94] Erhard Schürstab's Beschreibung des ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg / Hrsg. Joseph Bader, Vorstand des königlichen Archiv-Conservatoriums in Nürnberg /München 1860 bei Georg Franz
[95] Geschichte der Reichsstadt Nürnberg / Berabeitet von Leonhard Wilhelm Marx / J. A. Stein'sche Buchhandlung 1861 / Seite 322
[96] Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1506 bis 1598 bearbeitet von J. Heilmann / I. Band Kriegsgeschichte und Kriegswesen von 1506-1598 / München 1868 G. J. Catta'sche Buchhandlung (insbes. Seite 123)
[97] Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1598 bis 1651 bearbeitet von J. Heilmann / II. Band Kriegsgeschichte und Kriegswesen von 1598-1651 / München 1868 G. J. Catta'sche Buchhandlung
[98] Website: Wikipedia Deutscher Krieg 1866
[99] Website: Wikipedia Auflösung des Deutschen Bundes
[100] Website: Matricula Online / Sterbefälle Pavelsbach 01.01.1812 - 31.12.1857 / Seite 09.0053 / vorletzte Zeile
[101] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Juli 2025
[102] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Juni 2025
[103] Bericht auf der Website der Firma Schaller: "80 Jahre: World´s Finest Guitar Parts" / Auf Website abgerufen am 25.07.2025
[104] Chronik des TSV Pavelsbach / Auf Website des TSV abgerufen am 25.07.2025
[105] Website: Wikipedia Reichsdeputationshauptschluss
[106] Sterbebild des Siegert Josef aus 1929
[107] Website: Wiederherstellung der Kommunalen Selbstverwaltung 1945-1952 im Internet abgerufen unter: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Gemeindeverfassung_(19./20._Jahrhundert)#Wiederherstellung_der_kommunalen_Selbstverwaltung_1945-1952
[108] Kriegstagebuch der SS-Panzer-Grenadier-Division "Götz von Berlichingen"
[109] Website: Wikipedia Vierter Koalitionskrieg
[110] Website: Wikipedia Große Fränkische Diebes- und Räuberbande
[111] Website: Wikipedia Fünfter Koalitionskrieg
[112] Website: Wikipedia Louis-Nicolas Davout
[113] Website: Matricula Online / Taufen Pavelsbach 1780-1812 / Trauungen Pavelsbach 1812-1857
[114] Website: Wikipedia Franzosenzeit
[115] Website: Wikipedia Rheinbund
[116] Website: Bibliothek der Katholischen Universität Eichstätt: Pontifikale Gundekarianum (Seiten 58 + 59)
[117] Website: Wikipedia Hussitenkriege
[118] Historischer Verein Neumarkt / 15. Jahresbericht (1955-1957) / 10. „Steinkreuze – Zeugen mittelalterlicher Justiz“ (1955) / Franz Lehmeier - München / Seiten 63+64
[119] Diözesanarchiv Eichstätt
[120] Website: Wikipedia Hallstattzeit bzw. Ältere Eisenzeit
[121] Website: Luftbild Oberpfalz / Kappl-Wallfahrtskirchen
[122] Broschüre "10 Jahre Wiederaufbau Landkreis Neumarkt-Oberpfalz" / Herausgegeben vom der "Arbeitsgemeinschaft Westlicher Jura" / Druck: Verlagsdruckerein Neumarkt-Oberpfalz GmbH
[123] 19. Jahresbericht des Historischen Vereins Neumarkt und Umg. / Die revolutionären Ereignisse von 1848 in Neumarkt und Umg. von Hans Meier (Seiten 68-89)
[124] 2. Jahresbericht des Historischen Vereins Neumarkt und Umg. / Die Regesten des Klosters Seligenporten Teil I 1242-1342 von F. X. Buchner, Pfarrer in Sulzbürg
[125] 28. Jahresbericht des Historischen Vereins Neumarkt und Umg. / Zeittafel zur Pest in Neumarkt und der westlichen Oberpfalz von Rudi Bayerl (Seiten 87-100)
[126] Broschüre "Kirche St. Leonhard" / Verfasser Kreisheimatpfleger Herbert Lang / Überarbeitet 2011 durch Hans Pröpster Pavelsbach / Druck: Fuchs GmbH Pollanten
[127] Website: Wikipedia Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung
[128] Website: Wikipedia / Bistum Eichstätt / Michelbach, Ortskapelle St. Maria
[129] Website: Wikipedia Peter von Lacy
[130] Neumarkter Historische Beiträge Band 5 / J. D. Köhler / Geschichte der Wolfsteiner / Aus dem lateinischen übersetzt und kommentiert von Herbert Rädle / herausgegeben vom Historischen Verein für Neumarkt i.d.Opf und Umgebung / Druck durch Druckerei Fuchs, Gutenbergstr. 1, 92334 Berching-Pollanten
[131] Neumarkter Historische Beiträge Band 8 / Franz Seraph Schweninger / Medizinische Topographie und Ethnographie des Physikatsbezirks Neumarkt in der Oberpfalz vom 31.12.1860 / herausgegeben vom Historischen Verein für Neumarkt i.d.Opf und Umgebung / Druck durch Bögl-Druck, Mariahilfstraße 59a, Neumarkt i.d.Opf. / Frank Präger (Hersg.)
[132] 1. Jahresbericht des Historischen Vereins Neumarkt i.d.Opf und Umgebung für die Jahre 1904 und 1905 / Regesten der in der städtischen Registratur zu Neumarkt i.O. aufbeharten älteren Urkunden. / Bearbeitet von Kurt Romstöck / Seite 37
[133] 1. Jahresbericht des Historischen Vereins Neumarkt i.d.Opf und Umgebung für die Jahre 1904 und 1905 / Regesten der in der städtischen Registratur zu Neumarkt i.O. aufbeharten älteren Urkunden. / Bearbeitet von Kurt Romstöck / Seiten 37 + 38
[136] Website: Althochdeutsches Wörterbuch / Hrsg.: Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
[137] Website: Bayerische StaatsBibliothek / Historischer Atlas von Bayern - Vergriffene Bände / Altbayern Reihe I Heft 16 / Kommission für Bayerische Landesgeschichte München 1978 / Neumarkt von Bernhard Heinloth
[138] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng März 2024
[139] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng August 2008 + Januar 2009
[140] Website: Bayerische Staatsbibliothek / Historischer Atlas von Bayern - Vergriffene Bände / Teil Franken / Reihe I Heft 24 / Kommission für Bayerische Landesgeschichte München 1978 / Hilpoltstein von Wolfgang Wiessner
[141] Artikel des Neumarkter Tagblatts sowie Kurzbericht der Neumarkter Nachrichten jeweils vom 14.01.1991
[142] Mitteilungsblätter der Marktgemeinde Postbauer-Heng August + September + Oktober 2005 + Juli 2006
[143] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng November 2005
[144] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Juni 2008
[145] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Januar 2011
[146] Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Postbauer-Heng Juli 2012
[147] Website: Wikipedia Lengenbach
[148] Website: Wikipedia Allersberg
[149] Website: Wikipedia Französische Revolution
[150] Website: Wikipedia Erster Koalitionskrieg
[151] Website: Haus der Bayerischen Geschichte / Vertrag von Bogenhausen
[152] Website: Haus der Bayerischen Geschichte / Das Entscheidungsjahr 1805
[153] Website: Haus der Bayerischen Geschichte / Die Begründung der bayerischen Königswürde
[154] Website: Wikipedia Deutscher Bund
[155] Website: Wikipedia Friedrich II. (HRR)
[156] Website: Wikipedia Heinrich Raspe IV.
[157] Website: Wikipedia Wilhelm von Holland
[158] Website: Wikipedia Schlacht bei Regensburg
[159] Broschüre 25 Jahre Gemeinde Postbauer-Heng, Juni 1996
[160] Fritz Schnelbögl und Hanns Hubert Hofmann: "Gelegenait der landschaft mitsampt den furten und helltten darinnen" Eine politisch-statistische, wehr- und verkehrsgeograpfische Beschreibung des Großraums um Nürnberg aus dem Jahre 1504; Karl Pfeiffer's Buchdruckerei und Verlag, Herbruck in 1952 (Seite 44)
Hinweis zum Heimatarchiv der Marktgemeinde Postbauer-Heng: [102]
Das Heimatarchiv der Marktgemeinde befindet sich im ersten Stock des Feuerwehrhauses im Centrum und ist Donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 geöffnet. Um Einlaß zu erhalten, bitte am Haupteingang (in der Nähe des Briefkastens) klingeln. [102 Seite 11]
















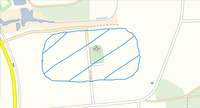









































































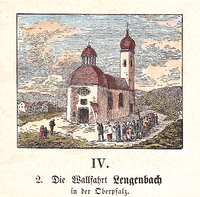





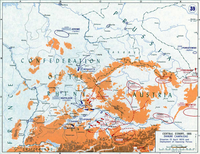




















































%20Anfang%202016%20am%20tisch%20Georg%20und%20Theres%20Schr%C3%B6dl%20mit%20Tochter%20im%20Arm%20evtl%20Jagdp%C3%A4cher%20Zeder%20aus%20N%C3%BCrnberg.png/picture-200?_=18e6bfd1d30)

%201887-1938.png/picture-200?_=1964847911f)


.png/picture-200?_=196485d615b)








.png/picture-200?_=18e6fefb808)



%201887-1938.png/picture-200?_=19647d9b460)

























.png/picture-200?_=1948cf71a41)


.png/picture-200?_=19af48319a8)





























































